Buchbesprechung: Wider den Status quo: Wie Deutschland wieder innovativer wird
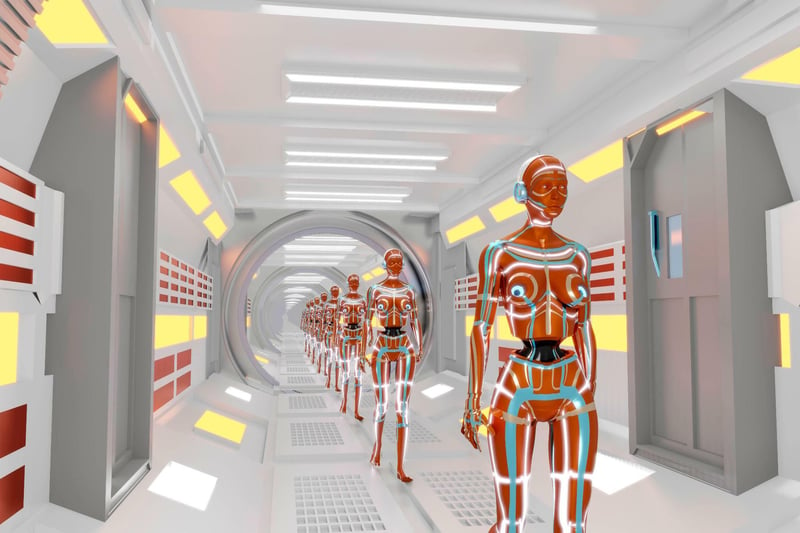
Mario Herger fragt sich, warum man sich in Deutschland erst dann mit neuen Innovationen auseinandersetzt, wenn sie anderswo schon als altbacken gelten.
Düsseldorf. Und plötzlich sind virtuelle Meetings ganz normal. Im Frühjahr 2020 musste alles ganz schnell gehen. Präsenzkonferenzen wurden abgesagt, durch Videotreffen ersetzt. Hektisch trugen Angestellte Monitore aus Bürogebäuden. IT-Abteilungen machten Überstunden, um Unternehmen Remote-Working-tauglich zu machen. Programme wie „Slack“ oder „Teams“, die seit Jahren ungenutzt auf Bürocomputern geschlummert hatten, wurden aus heiterem Himmel essenzieller Bestandteil des Arbeitsalltags.
Noch heute klopft sich die deutsche Wirtschaft deshalb kollektiv auf die Schultern. Man habe Improvisationsreichtum bewiesen, rasch reagiert, um seine Mitarbeiter in der Pandemie zu schützen, lautet der Tenor. Aber wie kann es sein, dass all das überhaupt nötig war?
Das fragt sich Mario Herger in seinem neuen Buch „Future Angst“. Dass „Zoom“ und Co. für viele deutsche Unternehmen zu Pandemiebeginn Neuland waren, habe ihn baff gemacht, schreibt er. Denn: „Spätestens seit meinem Umzug in die USA im Jahr 2001 gehörten solche virtuellen Konferenzen für mich zum Alltag.“
Herger ist promovierter Chemiker, war lange bei SAP. Seit einigen Jahren arbeitet er im Silicon Valley als Unternehmensberater und hält Vorträge zu Technologietrends und digitaler Disruption. Zuletzt schrieb er Bücher über Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und das Mindset des Silicon Valley.
In „Future Angst“ wird er genereller und beschäftigt sich mit der Frage, was genau Deutschland heute eigentlich von diesem Mindset trennt. Und mit der Frage, warum das Land, das einst formelhaft als Ort der Dichter und Denker galt, sich inzwischen erst dann mit neuen Innovationen auseinandersetzt, wenn sie anderswo schon als altbacken gelten.
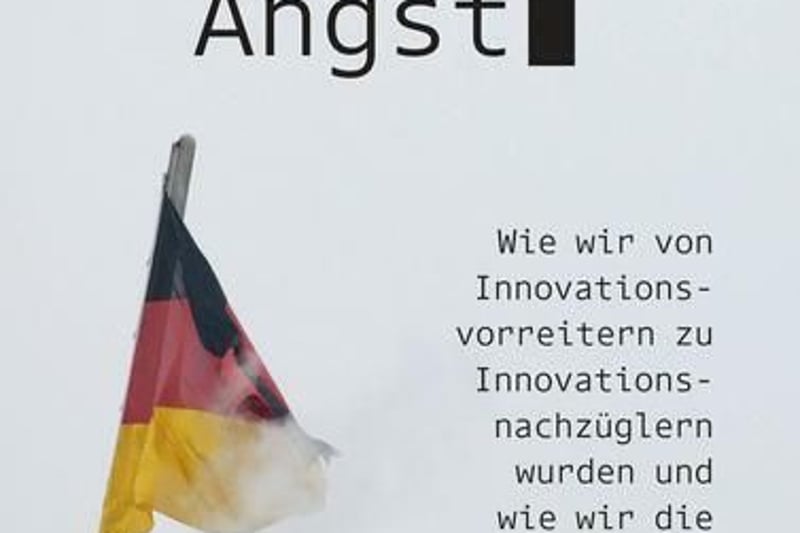
Die verknappte Antwort darauf liefert schon der Titel seines Buchs: Zu häufig ist es die Angst, die die deutsche Wirtschaft lenkt. Angst vor neuen Ideen, vor Veränderungen, vor Fehlern und vor falschen Entscheidungen. Es ist auch viel einfacher, sich in der Bequemlichkeit des Status quo zu sonnen.
Auch die im angelsächsischen Raum komplementär zum Stereotyp der „German Angst“ verwendete „German assertiveness“, die typisch deutsche Überheblichkeit, ist also Teil des Problems. Und dort, wo Zögerlichkeit und Arroganz zusammentreffen, kann Innovation schlichtweg nicht gedeihen.
Die Bücher über Technologie, die sich in Deutschland am besten verkauften, seien stets die, die die Bedrohung durch das Fremde nach vorn stellten, schreibt Herger. Er bezeichnet die Autoren solcher Werke als „Moralunternehmer“, nennt als medienpräsente Beispiele Anders Indset und Richard David Precht, die vor einer Massenarbeitslosigkeit als Folge der Digitalisierung warnen.
Der Zuspruch, den die Angesprochenen mit ihren „zitierbaren Bonmots“ ernten, ist für Herger Symptom für eine negative Geisteshaltung in der deutschen Gesellschaft und Unternehmerschaft, „ein mentales Hindernis, um Chancen zu ergreifen und Großes zu leisten“. Zwar seien Menschen evolutionär darauf konditioniert, Bedrohungen größere Aufmerksamkeit zu widmen als positiven Aspekten. Aber: „Warum sollten wir nicht mehr von den Chancen haben und dafür weniger von den Risiken?“
Hergers Argumentation ist an dieser Stelle schlüssig. Die technologischen Umbrüche der Vergangenheit haben gezeigt: Wenn Jobs obsolet werden, entstehen immer auch neue Arbeitsfelder. Dennoch muss sich der Autor den Vorwurf gefallen lassen, ganz ähnlich zu verfahren wie diejenigen, die er kritisiert. Auch die Rolle als „Anti-Moralunternehmer“, die Herger für sich beansprucht, bildet nur eine reduzierte Sichtweise auf die Zukunft ab.
Die Argumente der Techikskeptiker haben sich nicht verändert
Immerhin kann der Autor seinen Appell für mehr Technologieoptimismus mit historischen Beispielen untermauern. Denn: Vieles, das heute so alltäglich ist, dass wir es überhaupt nicht mehr als Technologie wahrnehmen, galt anfangs als gefährlich – ob Aufzug, Mülleimer, elektrisches Licht oder Regenschirm.
Die Gründe, die im Einzelfall dahinterstehen, muten heute absurd an – aber nur auf den ersten Blick. Denn die Argumente der Technikskeptiker sind im Wesentlichen noch immer dieselben: Sie berufen sich auf Traditionen, sorgen sich vor fremder Beeinflussung, Unmittelbarkeitsverlust und vor vermeintlichen Auswirkungen auf die Gesundheit.
„Erfinder, Wissenschaftler, Technologen und Ingenieure haben kein Problem damit, technologische Probleme zu lösen“, schreibt Herger am Ende seines Ausflugs in die Innovationsgeschichte. Die wahre Herausforderung sei die, Menschen psychologisch auf neue Technologie vorzubereiten. „Und das haben wir nie gelernt.“
Das gilt umso mehr für digitale Technologien und die wichtigsten beiden Technologietrends, die die Wirtschaft jetzt und in Zukunft umtreiben: Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Sie hätten etwas Geheimnisvolles an sich, schreibt Herger, seien dadurch beinahe ein „modernes Äquivalent zum Göttlichen“. Statt mechanischer Teile bewegten sich Elektronen, die unsichtbar seien.
Dass die Angst vor dem nicht Greifbaren in der deutschen Wirtschaft tief verankert ist, zeigt einmal mehr das Beispiel des Homeoffice: Dass viele Unternehmen sich hierzulande erst darauf einlassen konnten, als es die Coronakrise alternativlos machte, liege begründet in einer „Angst vor dem Kontrollverlust“, schreibt Herger.
„Nur durch die physische Anwesenheit der Mitarbeiter im Büro meinte man, auch tatsächlich Arbeitsleistung zu erhalten. Was man nicht sehen konnte, existierte nicht – eine Denkweise, die auch das tief verankerte Misstrauen gegen digitale Technologien in unserer Gesellschaft erklärt.“
Wenn „Tradition“ zum Unwort wird
Dieses Misstrauen gegenüber Neuem spiegele sich auch in der sinkenden Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland wider: Laut Daten der staatlichen Förderbank KfW hat sich der Anteil der Gründer an der Erwerbsbevölkerung hierzulande seit 2004 halbiert. „Es scheint fast so, als ob wir zu einer Kultur mit immer weniger Ambitionen werden“, attestiert der Autor.
„Tradition“ ist für ihn deshalb ein Unwort und gehört schleunigst aus dem Wortschatz von Unternehmern gestrichen. Sätze wie „Das haben wir immer so gemacht“ oder „Ändere nie ein funktionierendes System“ sind für Herger Beispiele für die sogenannte „Status-quo-Verzerrung“, eine Glorifizierung des Stands der Dinge, die auf „Existenzangst, der Verlustvermeidung, dem Unterlassungseffekt, aber auch dem Mangel an Information oder einer kognitiven Limitation“ basiert.
Es gebe viele nachahmenswerte Eigenschaften, die deutsche Unternehmen vorweisen könnten, schreibt Herger. Aber darauf stolz zu sein könne „zu einer Gratwanderung werden, die rasch in Arroganz abgleitet“. Diese Arroganz wiederum könne schnell „zu einem massiven Problem werden und ganze Wirtschaftszweige gefährden“.
Das zeige sich etwa am Beispiel Teslas und Elon Musks. Lange Zeit habe die deutsche Autoindustrie den amerikanischen Marktneuling und seinen extravaganten Vorstandschef aus einer trügerischen Überheblichkeit heraus belächelt, statt sich ein Beispiel zu nehmen – etwa im Hinblick auf eine agile Unternehmenskultur und einen Fokus auf neue Zukunftstechnologie statt auf zurückliegende Umsatzzahlen. Erst als Teslas Vorsprung in der E-Mobilität beinahe uneinholbar geworden war, begannen die deutschen Unternehmen umzudenken.
Was konkret aber können Unternehmen tun, um der „Status-quo-Verzerrung“ nicht zu erliegen, innovativ zu werden und es auch zu bleiben? Konkrete Ansätze dafür liefert Thorsten Reiter in seinem Buch „Killing Innovation“. Und macht dabei direkt klar: Auch das von Mario Herger verklärte Silicon Valley ist nicht gegen Überheblichkeit und Bequemlichkeit gefeit.
Ausgerechnet Apple, vermeintlich der Vorzeige-Innovator schlechthin, führt Reiter als Beispiel für ein Unternehmen an, das seine Innovationskraft zu verlieren droht. Der „letzte innovative Knalleffekt“ des Unternehmens liege schon lange zurück.

Reiter ist Wirtschaftswissenschaftler und bezeichnet sich selbst als Experten für Innovationen und Unternehmensstrategie. Sein neues Buch mutet optisch ein wenig wie ein drittklassiger Kriminalroman an und reitet den schon anfangs nicht sonderlich witzigen Gag vom „Mord“ an der Innovation über 160 Seiten zu Tode. Dazwischen aber wartet er mit erfrischenden Gedanken und Modellen auf, mit einem klaren Leitfaden dazu, wie Unternehmen sich innovationsfähig aufstellen – und wie sie es vor allem bleiben können.
Reiter unterteilt die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens in drei Elemente: Wahrnehmen, Ergreifen und Transformation. Gemeint ist damit, dass Chancen und Risiken zunächst erkannt, dann genutzt beziehungsweise abgewehrt werden müssen – und schließlich ein „kontinuierliches Neuausrichten der internen Ressourcenbasis, Kompetenzen, Prozesse und Strukturen auf eine nach der Innovation veränderte Realität“ einsetzen muss, um Innovationskraft hervorzubringen.
Diese Elemente müssten zur institutionellen Logik eines Unternehmens werden, sich bestenfalls in eigenen Innovationsabteilungen manifestieren, damit Innovationsfähigkeit nicht jedes Mal von Neuem aufgebaut werden muss und auf neue Disruptionen schnell reagiert werden kann.
Innovation benötige eine konkrete Vision, eine klare langfristige Perspektive und nicht nur den kurzfristigen Blick auf der Suche nach der nächstbesten Chance, schreibt Reiter. Schon eine einzige Veränderung innerhalb des Unternehmensgefüges, etwa der Wechsel von einem technologiefixierten auf einen marketingorientierten CEO, könne die Innovationskraft massiv gefährden. Reiter spricht hier von „politischen, funktionalen und sozialen Zerstörern“ und warnt: Innovation sei in Unternehmen stets schutzbedürftig, „denn Stillstand siegt von allein“.
In mindestens einem sind sich Herger und Reiter einig: Der geniale Einzelgänger, der sich in sein Labor einschließt, um Innovatives hervorzubringen, ist ein Mythos. Innovationen sind vielmehr Teamleistungen, die produktive Bedingungen zum Gedeihen brauchen. Die enden beim einzelnen Mitarbeiter, führen über die Unternehmenskultur und die Politik, beginnen aber bereits mit der gesellschaftlichen Mentalität.






„Wir sollten die notwendigen Schritte von einem pessimistischen zu einem optimistischen Weltbild tun“, schreibt Mario Herger in „Future Angst“. Wer intuitiv ängstlich auf Neues reagiere, könne aktiv gegensteuern. „Das gilt für jeden Einzelnen, aber auch für Unternehmen und selbst das ganze Land.“





