Literatur: Kritik am Kapitalismus – Die Grenzen des Wachstums

Die Kritik am Kapitalismus ist groß. Jedoch gibt es kaum erfolgversprechende Alternativen.
Der Kapitalismus macht es seinen Kritikern gerade nicht sonderlich schwer: Die Marktliberalisierungen der 80er mündeten in der steuerfinanzierten Staatshaftung für Banken, die sich verzockt hatten. Die Ideologie der offenen Märkte, die sich vermeintlich selbst regulieren, führte zu einer Energieabhängigkeit Deutschlands von einem revisionistischen und imperialistischen Herrscher im Kreml.
Die Wachstumsabhängigkeit des Systems, die Kultur des immer mehr, immer größer, immer schneller, beschleunigt den Klimawandel und gefährdet womöglich die Grundlagen unserer Existenz. Und nicht zuletzt fördert der Kapitalismus die Ungleichheit der Gesellschaften in solchem Maße, dass es für die Ränder des politischen Spektrums ein Leichtes ist, mit populistischen Parolen die „Abgehängten“ einzufangen – und die politischen Systeme von innen heraus zu destabilisieren.
So weit die schnellen und gängigen (Vor-)Urteile über unser marktwirtschaftliches System. Der Zeitgeist ist ohne Zweifel antikapitalistisch. Und auch die beiden US-Philosophen Nancy Fraser und Michael Sandel können sich mit ihrem kapitalismuskritischen Ansatz der Aufmerksamkeit sicher sein – und eines entsprechenden Absatzes ihrer Bücher.
„Das Unbehagen in der Demokratie. Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben“ – so der Titel von Sandels Werk.
Es ist eine Abrechnung mit dem „Finanzkapitalismus“. Sandel, von dem sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz inspirieren lässt, leistet eine reflektierte, lesenswerte Analyse der Schwächen der US-Demokratie.
Klassenkämpferischer Sound
Auch das Erkenntnisinteresse seiner New Yorker Kollegin Fraser richtet sich vor allem auf die Missstände der größten Volkswirtschaft. Doch allein der reißerische Titel „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ zeigt: Fraser will provozieren. Der Sound ist klassenkämpferisch, streckenweise polemisch.
Sandel geht filigraner vor. Zwar sieht auch er die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens gefährdet. „Kapitalismus und Demokratie haben lange in einer angespannten Koexistenz gelebt“, schreibt er. Der Kapitalismus strebe danach, „produktive Tätigkeit für privaten Gewinn zu organisieren“. Die Demokratie strebe dagegen an, „Bürger zu gemeinschaftlicher Selbstverwaltung zu ermächtigen“. Die politische Ökonomie der Demokratie, so der Harvard-Philosoph, sei „von Beginn an ein Versuch, diese beiden Konzepte zu vereinen“.
Diesen Versuch betrachtet er als gescheitert. Die Leitvorstellungen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik orientierten sich nach Sandels Auffassung immer weniger an den „Bedingungen und Möglichkeiten republikanischer Partizipation, sondern an ökonomischen Effizienzvorstellungen“.
Vor allem von den demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama sieht sich Sandel enttäuscht. Sie hätten keineswegs mit der Reagan-Tradition gebrochen, sondern die marktgläubige Ideologie der 1980er-Jahre mit ihrer umfangreichen Deregulierungspolitik der Finanzmärkte noch verschärft. Und zwar mit dem Scheinargument, nur auf diese Weise Wirtschaftswachstum und Verteilungsgerechtigkeit herstellen zu können.
Aus Sandels Sicht war das eine Mär. Und tatsächlich hat nichts den Kapitalismus so in eine Legitimationskrise gestürzt wie der Fakt, dass die Verluste unverantwortlich spekulierender Banken kollektiviert wurden, weil andernfalls das Finanzsystem kollabiert wäre. Mehr noch: Dass das System den Banken den Anreiz gab zu zocken, weil sie davon ausgehen durften, dass der Staat sie retten würde. „Too big to fail“ – das war eine Art Vollkaskoversicherung in einem außer Kontrolle geratenen Finanzkapitalismus.

Dass dieses Problem, auch „Moral Hazard“ genannt, bis heute nicht gelöst ist, zeigen die jüngsten Banken-Rettungsaktionen in den USA und in der Schweiz. Den möglichen Einwand, dass es damals wie heute keine Entscheidung des Marktes war, die Banken mit Steuergeldern zu retten, sondern eine der Politik, thematisiert Sandel nicht. Sein Hauptanliegen ist eine Rückgewinnung der Souveränität der Politik gegenüber der Ökonomie, weg vom vermeintlich rationalen Effizienzdenken, hin zu einer Politik, die auf einer ethisch gut begründeten praktischen Philosophie basiert.
Und der Philosoph macht keinen Hehl daraus, dass er im Politikwechsel des US-Präsidenten Joe Biden mit seinen kreditfinanzierten Billionen-Investitionen eine Befreiung der Politik von einem rein durch ökonomisches Kalkül bestimmten Dogma sieht. Nur eine solche Politik, die die Reduzierung des Liberalismus auf den Marktglauben überwindet, könne gleichermaßen das „Unbehagen in der Demokratie“ verringern. Seinen Höhepunkt, so Sandel, fand dieses Unbehagen in Donald Trump, seine Wegbereiter allerdings seien Clinton und Obama gewesen.
Mehr zum Thema Literatur:
Fraser, die große amerikanische Feministin, geht ungleich radikaler vor als Sandel. Es scheint für sie kaum ein Übel zu geben, dessen Ursache sich nicht im Kapitalismus finden lässt. Fraser nennt die vier schwerwiegendsten: Der Kapitalismus sei erstens aufs „Engste mit dem Rassismus verzahnt“. Er nähre sich zweitens von „Care-Arbeit“. Bedeutet: Der Kapitalismus sei für sein Fortbestehen auf die sich außerhalb seiner Kreise vollziehende soziale Reproduktion wie Kindererziehung und Pflege angewiesen, die er selbst aber beständig unter Druck setzt, etwa durch sinkende Reallöhne.
Drittens verfeuere der Kapitalismus unsere begrenzten ökologischen Ressourcen, weil „seine Eigenlogik ihn zwingt, diese Ressourcen als Teil eines außerwirtschaftlichen Bereichs zu definieren und sie sich einzuverleiben“. Und schließlich verschleiße der Kapitalismus die „immateriellen Ressourcen der Demokratie“: Er sei „auf eine legitime staatliche Ordnung angewiesen“, unterminiere sie aber, da er in der ökonomischen Sphäre nur die Kräfte des Marktes gelten lässt.
Gedankliche Anleihen bei Marx
Mehr Antikapitalismus geht nicht – zumal diese vier „Vernichtungsdynamiken“ einander bedingen und sich wechselseitig verstärken. Fraser, die sich in der Tradition der Frankfurter Schule um die linksgerichteten Philosophen Theodor Adorno und Max Horkheimer („Dialektik der Aufklärung“) sieht, beansprucht, unseren Blick auf den Kapitalismus zu erweitern und „alle Unterdrückungen, Widersprüche und Konflikte der gegenwärtigen Situation in einem einzigen analytischen Rahmen zusammenzufassen“.
Meinungsstark, emotional und mit kraftvollen Metaphern ausgestattet zieht Fraser gegen jenes System zu Felde, das es „zu zähmen“ gilt. Wobei der Kapitalismus – und hier nimmt Fraser Anleihen bei Marx – selbst Hilfestellung leiste. Denn er trage eine „kannibalische Dynamik“ in sich, „verschlinge alles, und am Ende auch sich selbst“. Von Menschen etabliert, sei er eine Fressorgie, „deren Hauptgericht wir selbst sind“. Die Selbstzerstörung gehöre zur „DNA des Kapitalismus“.
Wirklich überzeugend sind die Tiraden Frasers nicht: Eine kraftvolle Sprache kann analytische Tiefe und das differenzierte Argument nicht ersetzen. Wenn es konkret wird, rutscht die Autorin teils ins Absurde ab – etwa wo die New Yorkerin gegen den Einsatz von Kunstdünger polemisiert.
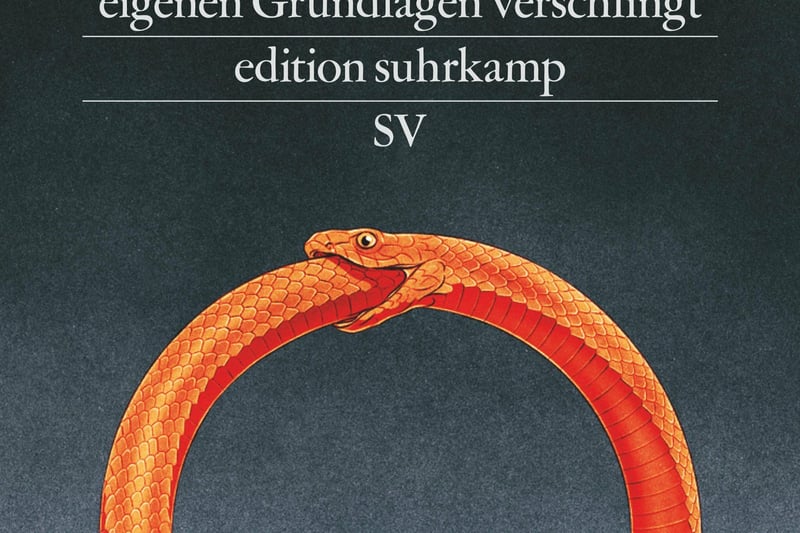
Für Fraser wie Sandel gilt: Beide überbetonen die Schwächen des Kapitalismus und ignorieren weitgehend seine Stärken: etwa der breitere Wohlstand, die höhere Lebenserwartung, die niedrigere Kindersterblichkeit. Oder die Tatsache, dass sich das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern zunehmend vom Verbrauch fossiler Energieträger entkoppelt.
Beide unterschätzen die jüngste Trendwende hin zu einem mächtigen, intervenierenden Staat. Die neue Staatsgläubigkeit zeigt sich in Europa und seit Neuestem auch in den USA. Überall Rettungspakete und Konjunkturprogramme in völlig neuer Dimension, überall rasant steigende Staatsverschuldung.
Das passt nicht zur These der beiden Philosophen, dass sich der Markt der Demokratie bemächtige. Marktwirtschaft und Demokratie brauchen einander, sie eint der Freiheitsgedanke, dass die beste Idee sich im Wettbewerb innerhalb eines offenen Systems entwickeln kann. Ein solches System gewährleistet in der langen Frist immer noch am besten die notwendige Korrektur- und Reformfähigkeit.
>>Lesen Sie hier: Warum es kein Ende des Kapitalismus gibt





Die Tatsache, dass das Wohlstands- und Freiheitsversprechen westlicher Gesellschaften unter Verdacht, mitunter Generalverdacht stehen, ist besorgniserregend. Antikapitalistische Thesen waren immer schon massentauglich, mittlerweile sind es auch antimarktwirtschaftliche Parolen.
Das Problem: Weder Sandel noch Fraser nennen erfolgversprechende Alternativen. Und was sie verschweigen: Die Marktwirtschaft ist am Ende auch Ausdruck intellektueller Bescheidenheit, also der erkenntnistheoretischen Einsicht, dass niemand weiß, welcher der richtige, der wahre Weg ist. Auch das ist Philosophie.
Mehr: Was die moderne Arbeitswelt vom Landwirt übernehmen kann





