Paul Collier und John Kay: Ein Lob auf die Gemeinschaft

Abstand halten gilt als eines der obersten Gebote während der Pandemie.
Die Bewältigung der Corona-Pandemie erfordert eine paradoxe Kombination von sozialer Distanzierung und sozialer Solidarität. Wir müssen Abstand wahren, um das Virus nicht zu verbreiten; wir müssen zusammenkommen, um mit seinen Folgen fertigzuwerden.
Man beraubt uns der Gelegenheiten, unseren Freund_innen und Verwandten beizustehen oder unseren Kolleg_innen bei der Arbeit zu helfen; aber wir bieten uns freiwillig an, Lebensmittel auszufahren, und beklatschen Pflegekräfte. In unserem Buch „Das Ende der Gier“ betonen wir, wie wichtig und notwendig Solidarität auch in weniger aufgewühlten Zeiten ist.
In dem Maße, wie fortschreitende Impfkampagnen die Gesellschaften von den Covid-Ängsten befreien, haben wir Grund zum Optimismus, dass eine solche Solidarität erneuert werden kann. Die Pandemie hat uns auf eindringliche Weise vor Augen geführt, wie wichtig Gemeinschaft ist.
Oftmals werden Gemeinschaften mit einem bestimmten Ort (als „Gemeinden“) assoziiert. Aber es gibt noch viele andere Arten – Religionsgemeinschaften, Sportvereine, Buchklubs, Vogelbeobachtergruppen und Ehemaligenvereinigungen. Die Zivilgesellschaft setzt sich aus Vereinen und Verbänden mit gemeinsamen Werten und Normen zusammen.
Adam Smith, der Begründer der klassischen Nationalökonomie, war keineswegs jener Hohepriester des Individualismus, als der er von modernen Kommentatoren verehrt wird, die nicht mit seinem Werk vertraut sind, sondern vielmehr ein Kommunitarist.

Paul Collier ist Professor für Ökonomie und Direktor des Centre for the Study of African Economies an der Universität Oxford. Für sein Buch „Sozialer Kapitalismus“ erhielt er den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2019. (Foto: mauritius images)
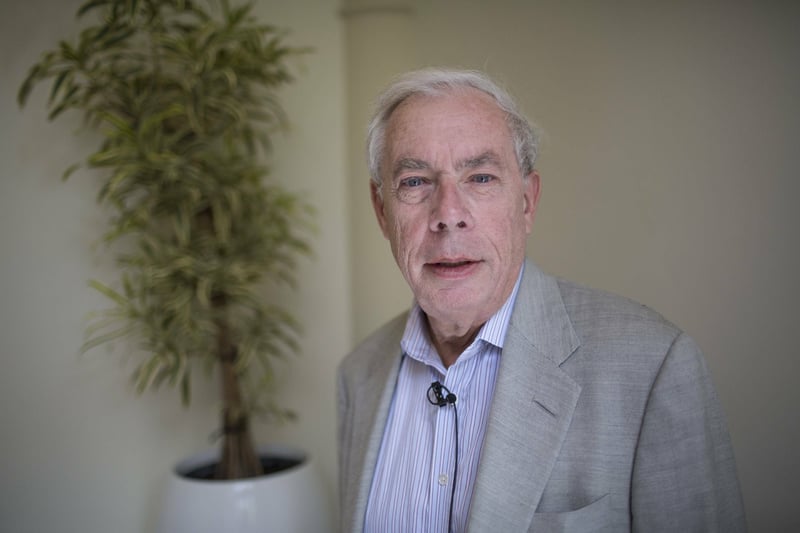
John Kay ist einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler Großbritanniens. Er lehrte an der London Business School, der Universität Oxford und der London School of Economics. (Foto: Getty Images)
Smiths philosophischer Beitrag war die Theorie der ethischen Gefühle (1759). Er bittet seine Leser_innen, ihre empathische Vorstellungskraft einzusetzen, um Dinge aus der Perspektive anderer Menschen zu betrachten – zu einem „unparteiischen Beobachter“ zu werden. Meine Unparteilichkeit erfordert keine Distanziertheit, sondern Verzicht auf den Egoismus.
Smiths unparteiischer Beobachter ist sich voll und ganz seiner Rolle in der gegenwärtigen Gesellschaft bewusst, und diese erfundene Figur führt zu einer Annäherung des „Ich“ an das „Wir“. Smith sah keinen Widerspruch zwischen den Argumenten im „Wohlstand der Nationen“ (1776) und denen in der „Theorie der ethischen Gefühle“. Die Beziehungen im Markt sind immer Beziehungen zwischen Menschen.
Während Mrs. Smith mit dem Bäcker und dem Metzger plauderte (der Weise heiratete nie, und seine Mutter führte ihm fast sein gesamtes Leben lang den Haushalt), schwatzte Adam mit David Hume, Adam Ferguson und der Gemeinschaft von Intellektuellen, die die Edinburgher Gesellschaft seiner Zeit auszeichnete.
In Smiths Welt dürfen wir durchaus unsere eigennützigen Interessen verfolgen – nicht zuletzt deshalb, weil wir sie besser verstehen als andere –, aber wir dürfen dies nicht auf Kosten anderer tun. Der Metzger agiert am Markt als Metzger, aber dadurch hört er nicht auf, ein Mensch zu sein, der in ein Netz von Verpflichtungen eingewoben ist.
Bereits zum Zeitpunkt der Geburt der Volkswirtschaftslehre waren mithin kommunitaristische Ideen im Umlauf. Unglücklicherweise wurden nach Smiths Tod seine Ideen über den Metzger als Händler zum Homo oeconomicus aufgebauscht, einer Kreatur, die er selbst verabscheut hätte, während seine Ideen über den Metzger als Mensch und die gute Gesellschaft als eine, die sich durch eine Harmonie der (ethischen) Gefühle auszeichnet, weitgehend in Vergessenheit geraten sind.
Nach Darwin war man fast hundert Jahre lang der festen Überzeugung, die Evolution begünstige den Homo oeconomicus: Die Gierigen und Egoisten würden andere im Wettstreit um Nahrung, Unterkunft und Paarungspartner erfolgreich ausstechen.
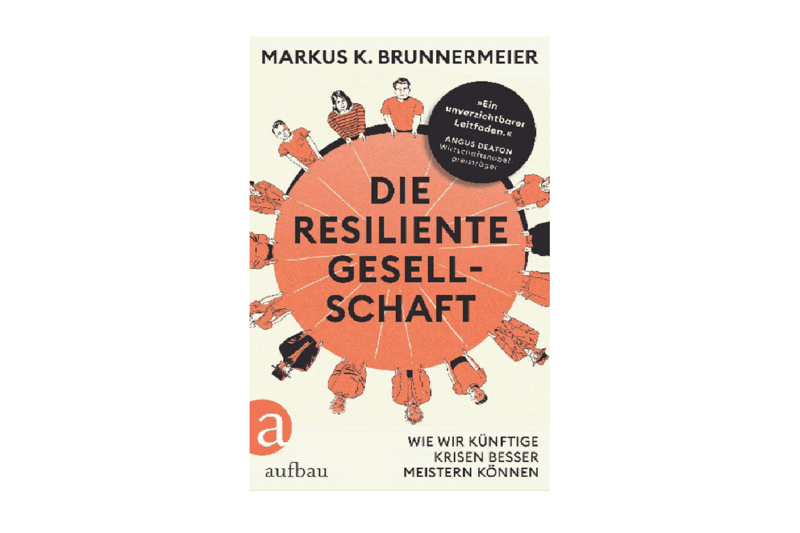
Das bessere Verständnis evolutionärer Prozesse, das in den 1960er-Jahren begann, und die in jüngster Zeit entstandene Evolutionspsychologie erzählen uns allerdings eine andere Geschichte. Der Mensch verdankt seinen evolutionären Erfolg demnach nicht der Tatsache, dass er egoistisch und gerissen ist, sondern seiner sozialen Natur. In gut funktionierenden Gesellschaften knüpfen und pflegen Menschen ein ausgedehntes Netz sozialer Kontakte, die auf Gefälligkeiten und wechselseitigen Verpflichtungen beruhen, zu denen der Homo oeconomicus nicht fähig wäre.
Wir sind bereit, im Streben nach Zugehörigkeit und Wertschätzung auf individuelle materielle Belohnungen zu verzichten. Wir wünschen uns nicht nur die Wertschätzung anderer – wir wollen gemocht werden –, sondern auch Selbstachtung – wir wollen also „liebenswert“ im Sinne von Smith sein.
Auf diese Weise werden wir moralisch „belastbar“ – fähig, Pflichten anzuerkennen und zu befolgen, die unser Verhalten verändern. Die Gene, denen wir unseren Erfolg als Spezies verdanken, sind Gene, die uns als Gruppe erfolgreich machen. Die langjährigen Debatten „Anlage versus Umwelt“ und „Gruppen- versus Individualselektion“ sind heute beigelegt: Beide Faktoren sind untrennbar miteinander verwoben.
Und dennoch gibt es ein Problem: die Vorteile, die damit verbunden sind, ein egoistisches Mitglied einer Gruppe zu sein, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, von dem all ihre Mitglieder profitieren. Erfolgreiche Menschengruppen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, können es nicht zulassen, dass Abweichler sich zugunsten ihrer eigenen Prioritäten über dieses Ziel hinwegsetzen. Und sie tun es nicht. Sie bestrafen „Trittbrettfahrer“ – Menschen, die die Vorteile kooperativer Aktivitäten beanspruchen, ohne etwas dazu beizutragen.
Selbst die Wertpapierhändler, die den Libor-Zinssatz und ganze Finanzmärkte manipuliert hatten, schickten einander E-Mails mit Sätzen wie „Du hast bei mir was gut“. Innerhalb ihrer eigenen Gruppe erkannten sie wechselseitige Verpflichtungen an, während sie gleichzeitig andere Marktteilnehmer_innen und den Fiskus abzockten.
Normalerweise dauert es, bis sich Ideen verbreiten, aber die jäh über uns hereingebrochene Coronakrise hat vielleicht den Moment vorverschoben, an dem die Gemeinschaft zeigt, was sie leisten kann. Weder Staaten noch Einzelpersonen können uns vor einem solchen Virus schützen. Demokratische Staaten haben nur eingeschränkte Mittel, um die Einhaltung von Regeln zu erzwingen: Wir sind Staatsbürger_innen, keine Untertanen. Menschen können sich nicht lebenslang isolieren. Unsere wichtigste Ressource ist die Gemeinschaft.
Die Pandemie verlangt uns allen etwas ab: Im besten Fall halten sich die meisten freiwillig an Regeln und Einschränkungen. Wie immer ist es so, dass die begrenzten Ressourcen zur Regeldurchsetzung nur dann ausreichen, wenn die unsozialen Egoisten in der Minderheit bleiben. Andernfalls werden wir als Gesellschaft die Folgen eines selbstbezogenen Individualismus schmerzlich zu spüren bekommen, weil Infizierte das Virus weiterhin verbreiten und Opportunisten von dem um sich greifenden Chaos profitieren.
Die „Gefallenenrede des Perikles“ aus dem Jahr 430 v. Chr., mit der wir unser Buch begonnen haben, rühmte Athen, die erste bürgerliche Gemeinschaft der Welt. Dann wurde die Stadt von einer Seuche heimgesucht, an der Perikles im Jahr darauf starb. Thukydides berichtet im oben zitierten Werk „Der Peloponnesische Krieg“, dass „die Pest für Athen der Anfang der Sittenlosigkeit war“. In Sparta wurde die Seuche durch rigorose repressive Maßnahmen in Schach gehalten. Athen hat sich nie mehr erholt und wurde in den anhaltenden Peloponnesischen Kriegen besiegt. Die Parallelen sind offensichtlich und verstörend.
Westeuropa ist es bislang gelungen, den sozialen Zusammenhalt nicht nur zu wahren, sondern zu stärken. Schon bald werden wir entweder einen Lobgesang auf den Geist des Zusammenhalts anstimmen oder die schrecklichen Folgen seines Verlusts zu spüren bekommen.
Wie Unternehmen profitieren
Wir sind pragmatische Ökonomen, keine romantischen Evangelisten. Wie allen Wirtschaftswissenschaftler_innen wurde auch uns beigebracht, dass die Gesellschaft aus Menschen besteht, die danach streben, ihren Eigennutz auf rationale Weise zu maximieren, und wir haben diese Lehrmeinung an unsere Studierenden weitergegeben.
Aber Pauls Erfahrung in afrikanischen Volkswirtschaften überzeugte ihn davon, dass Gesellschaften, die aus egoistischen, unabhängig voneinander ihre eigenen Interessen verfolgenden Akteuren bestehen und in denen sämtliche Beziehungen außerhalb der Familie oder Ethnie rein nutzenbasiert („transaktional“) sind, nicht nur zu den ärmsten weltweit gehören, sondern ohne tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel auch dazu verdammt sind, dies zu bleiben.
John erkannte, dass ein Unternehmensmodell, das davon ausgeht, dass alle Beziehungen nutzenbasiert sind, nichts darüber aussagt, wie erfolgreiche Unternehmen tatsächlich funktionieren, und dass die Finanzkrise von 2008 das absehbare Scheitern von Unternehmen demonstrierte, die sich an diesem Glaubenssatz orientiert hatten. Erfolgreiche Unternehmen bauen Gruppen kooperierender Individuen auf, greifen auf kollektives Wissen zurück und profitieren von der intrinsischen Motivation der meisten Beschäftigten, für ein erstrebenswertes Ziel zusammenzuarbeiten.
Der Staat kann – und sollte – nicht Träger sämtlicher Pflichten sein, befrachtet mit der Gewährleistung einer breiten Palette von ökonomischen Rechten und der Erfüllung von Aufgaben des „Weltretter“-Ethos oder der Förderung des BIP-Wachstums. Der Grundsatz der Subsidiarität weist die meisten Pflichten Organisationen auf viel niedrigerer Ebene zu; und der Staat ist der Diener seiner Bürgerinnen und Bürger, wie es in der partizipativen Demokratie zum Ausdruck kommt.


Individuum und Staat gelten nicht länger als antagonistische Gegenpole. An die Stelle dieser Sichtweise tritt ein Modell der Gesellschaft als ein Gefüge aus einer Unzahl kleiner Organisationen, in denen Menschen sich jeweils für ein gemeinsames Ziel engagieren und die in größeren Gruppierungen zusammenarbeiten, um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen. Individualismus ist Einsamkeit, nicht Befreiung; die Zuflucht im Bunker scheitert letztlich. Zugehörigkeit erlegt uns keine Bürden auf, vielmehr macht sie uns erst zu vollgültigen Menschen.
Mehr: Soziologe prognostiziert Rückbesinnung auf Nationalstaaten





