Kommentar – Der Chefökonom: Die Integration der Beamten in die Rentenversicherung wäre zu teuer
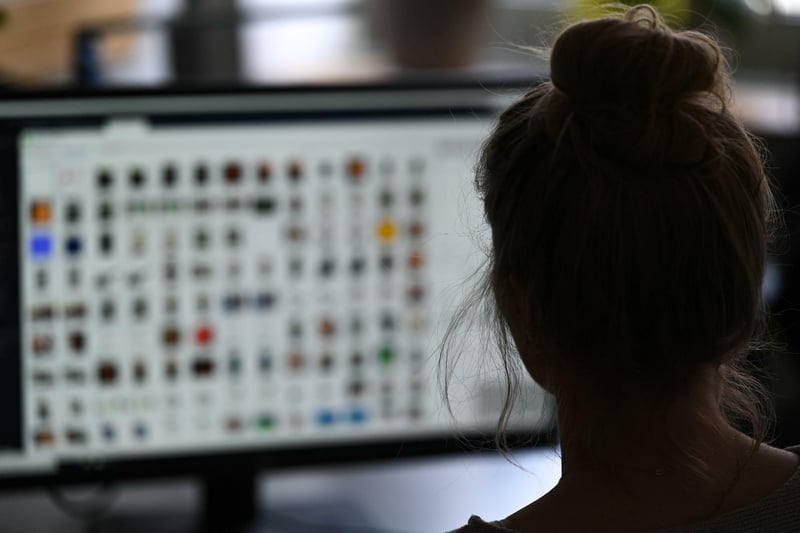
Die Integration von Beamten wäre kein sinnvoller Beitrag zur Sanierung der umlagefinanzierten Rentenversicherung.
Die gesetzliche Rentenversicherung ist mit über 40 Millionen aktiven, also zumeist beitragszahlenden Versicherten und 19 Millionen Leistungsempfängern das bei weitem wichtigste Alterssicherungssystem in Deutschland. Ungeachtet aller Kritik hat sich dieses umlagefinanzierte System in den vergangenen nahezu 65 Jahren bewährt.
Der bald einsetzende Alterungsschub der Gesellschaft jedoch wird zu einer massiven Belastungsprobe werden, denn ein sinkendes Erwerbspersonenpotenzial muss eine kräftig steigende Anzahl von Rentnern finanzieren.
Wie immer, wenn sich Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung abzeichnen, wird die Forderung laut, die zumeist besser verdienenden und im Alter privilegiert abgesicherten Beamten in dieses System einzubeziehen. Und in der Tat ist schwer einzusehen, dass zum Beispiel manche Lehrer an einer Schule verbeamtet und andere angestellt sind.
So ist es nicht verwunderlich, dass auch Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) in einem sonst seltenen Schulterschluss mit der Partei „Die Linke“ jüngst in einem Interview forderte: „Generell finde ich es richtig, darüber nachzudenken, im Laufe der Zeit alle in einer Erwerbstätigenversicherung zu vereinen.“ Es gehe darum, „dass wir langfristig ein System schaffen, das für alle gerecht ist“.





