Frage an Projektmanager: Kann ein digitales Lastenheft auch agil entwickelt werden?
Digitales Lastenheft
- 06.01.2023

Zielsetzung bei der Erstellung digitaler Lastenhefte
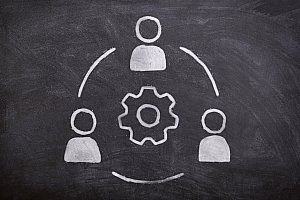
Moderne Tools helfen dabei, digitale Lastenhefte qualitativ hochwertiger und schneller zu erstellen. Sie beinhalten optimalerweise Komponenten zur...
• Definition der Anforderungen durch den Kunden
• Definition von Bewertungskriterien zur systematischen Bewertung der Angebote
• Unterstützung der Anbieter, die Anfrage gut zu verstehen und gezielte Rückfragen zu stellen
• schrittweisen Verfeinerung des Lastenheftes durch den Kunden inklusive gleichberechtigter Kommunikation mit den Anbietern
• Nachweis der Erfüllung der Anforderungen durch die Lösung des Anbieters
• objektiven und teilautomatisierten Bewertung und zum Vergleich der Angebote als Entscheidungsunterstützung durch den Kunden
Ergebnisse einer derartigen Unterstützung mit IT-Tools sind die wesentliche Beschleunigung und Aufwandsminimierung des Angebotsprozesses für alle Beteiligte, bessere und objektivere Entscheidungen, die Vermeidung von Fehlentscheidungen sowie die Minimierung von Risiken. In letzter Konsequenz führt ein digitales Lastenheft dazu, dass der Kunde mehr Anbieter anfragen und ihre Angebote vergleichen, damit bessere Lösungen finden und mehr Nutzen aus der Projektlösung in ihrem gesamten Lebenszyklus ziehen kann. Die Anbieter selbst profitieren von schnellen Antworten auf Rückfragen, beschleunigter Beauftragung durch teilautomatisierte Prozesse zur Entscheidungsfindung und Abwicklung sowie mehr Kundenanfragen und damit möglichen Referenzprojekten. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligte!
Digitales Lastenheft mit CBA Synergy erstellen

1. Das Projektteam wird durch eine wissensbasierte Generierung der Anforderungen im Wissensmanagementsystem CBA Compendio unterstützt, die den aktuellen Stand der Technik, Erfahrungen aus bisherigen Projekten und die Erfahrungen, Meinungen und Ideen der MitarbeiterInnen berücksichtigt.
2. In einem zweiten Schritt werden Bewertungskriterien für die Anforderungen definiert, die eine gleichberechtigte Behandlung aller Anbieter gewährleistet. Aus ihnen werden automatisch Fragen an die Anbieter generiert, die diese wie einen Fragebogen beantworten können. Die Antworten der Anbieter können später teilautomatisch ausgewertet werden.
3. Die Anbieter erhalten neben dem eigentlichen Lastenheft vielfältige Informationen zum Projektkontext, Begriffsdefinitionen im Glossar und können sich in dem ihnen freigegebenen Rahmen über Wissenswertes zum Projekt informieren. Sie haben die Möglichkeit, an den Kunden Rückfragen zu stellen.
4. Die Rückfragen können durch den Kunden schnell und unkompliziert beantwortet werden. Die Antworten sind allen Anbietern gleichzeitig in anonymisierter Form sichtbar.
5. Solche Rückfragen können auch zu Änderungen in der Anforderungsdefinition führen. Dank digitaler Form können Änderungen dabei flexibel sowie transparent übermittelt werden. Das bringt eine spürbare Reduktion des Koordinations- sowie Zeitaufwands.
6. Die Anbieter können die Fragebögen zu den Anforderungen sehr schnell und einfach beantworten. Es ergibt sich für alle Angebote ein systematisches Bild und eine gute Vergleichbarkeit.
7. Die Bewertung der Angebote kann neben automatisierten Bewertungsverfahren unter anderem über ExpertInnenmeinungen oder Umfragen zum Beispiel bei Key Usern erfolgen. Es erfolgt eine Konsolidierung der Bewertungen zu KPIs, die den Business Value einer Lösung charakterisieren und wichtig für die Entscheidungsfindung sind. Dabei bleibt den Anbietern ein hinreichender Rahmen, die Besonderheiten ihrer Lösungen darzustellen.
Dank digitaler Form können Änderungen flexibel sowie transparent übermittelt werden. Das bringt eine spürbare Reduktion des Koordinations- und Zeitaufwands. Es können mehr Anbieter angefragt werden, um dadurch gegebenenfalls intelligentere Lösungsansätze und attraktivere Angebote zu erhalten.
Es entsteht ein kooperativer Prozess zwischen Kunden und Anbietern und damit ein Wettbewerbsvorteil für beide Seiten. All das gelingt, indem CBA Project eine Reihe an praktischen Funktionen bietet. Dazu gehören Vorlagen für produktgruppen- und/oder unternehmensspezifische digitale Lasten- sowie Pflichtenhefte. Das bedeutet einen geringeren Aufwand, aber dennoch die Möglichkeit zur Individualisierung. Dank eines integrierten Workflows kann jeder Arbeitsschritt bei der Erstellung der Lastenhefte digital absolviert werden – vom Projektsteckbrief über die Anforderungsdefinition, die Abstimmung mit den Anbietern über die Lösungsfindung mithilfe unterschiedlicher Dialogfunktionen bis zur teilautomatisierten Entscheidungsgrundlage. Weitere Funktionen umfassen das teilautomatisierte Extrahieren von Anforderungen, Parametern, Anwendungsfällen sowie Bewertungskriterien aus der individuellen Wissensbasis und ein abschließendes Learning für Folgeprojekte.
Ein digitales Lastenheft ist nicht nur ein digitales Medium zur Erstellung von Lastenheften, sondern unterstützt auch den gesamten Vorprozess einer Beschaffung inhaltlich und bezieht die Anbieter in einem kooperativen Prozess ein. Es führt systematisch zur Auswahl der Lösung mit dem besten Business Value. Dies sind Mehrwerte, die nur ein agiles digitales Lastenheft erbringen kann.
CBA Synergy: Wettbewerbsvorteile erkennen und nutzen

Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ist in der modernen Arbeitswelt zu einem zentralen Erfolgsfaktor geworden. Die Nutzung von CBA Project ist daher ein wichtiger Meilenstein, um sich als Unternehmen erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Hierfür bietet CBA Synergy noch zahlreiche weitere Software-as-a-Service-Lösungen, die allesamt aus derselben Vision entstanden sind: Durch die Koordination der unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse Synergien zu schaffen und die IT zum Wertschöpfungsfaktor zu machen. Dafür entwickelt CBA Synergy cloudbasierte Anwendungen, um Unternehmensnetzwerke zu kreieren, ohne dabei an Flexibilität oder Eigenständigkeit zu verlieren.