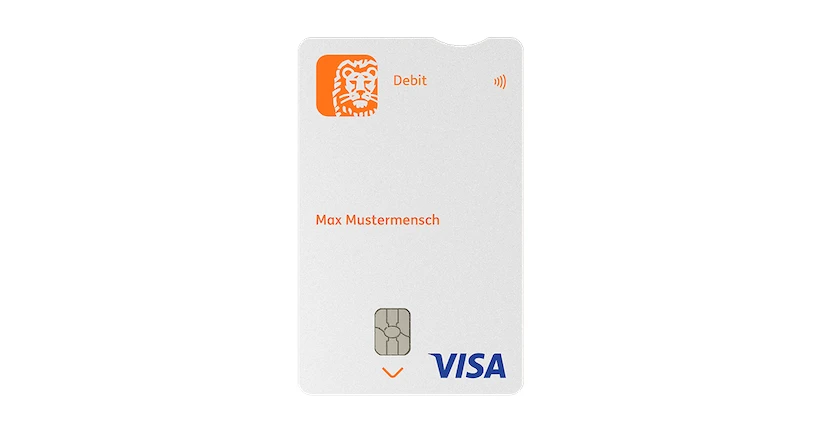Das Wichtigste in Kürze
- Die Unternehmensbewertung kann durch verschiedene Methoden wie das Ertragswertverfahren, das EBIT-Verfahren, das Substanzwertverfahren und die Marktwertmethode erfolgen.
- Jedes Verfahren hat seinen eigenen Fokus.
- Die Wahl des Verfahrens und verschiedene Faktoren können den endgültigen Wert eines Unternehmens erheblich beeinflussen.
Das eigene Unternehmen hat einen Wert – aber wie genau wird dieser ermittelt? Gerade für Handwerksbetriebe sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) ist es entscheidend, den eigenen Wert zu kennen; sei es für Investitionen, Kredite oder den Verkauf des Unternehmens. Es gibt allerdings verschiedene Methoden, um den Firmenwert zu berechnen. Dieser Artikel stellt die vier gängigsten Ansätze vor.
1. Das Ertragswertverfahren
Das Ertragswertverfahren ist eine der gebräuchlichsten Methoden zur Ermittlung des Unternehmenswertes. Es basiert auf den zukünftig erwarteten Erträgen des Unternehmens. In einfachen Worten: Was wird das Unternehmen wahrscheinlich in Zukunft erwirtschaften?
Der Ertragswert ergibt sich aus dem Barwert aller zu erwartenden Einnahmen-Überschüsse. Dabei wird dieser erwartete Gewinn durch einen sogenannten Kapitalisierungszinsfuß auf den heutigen Wert heruntergerechnet. Ein wichtiger Baustein hierbei ist die Prognose zukünftiger Erträge, die häufig auf den Ergebnissen der vorherigen Jahre basiert. Allerdings sind vergangene Erträge lediglich ein Faktor – die zukünftige Entwicklung kann durch diverse Einflussfaktoren variieren.
So wird der Ertragswert ermittelt
- Prognoseerstellung: Zunächst wird eine Markteinschätzung, basierend auf bisherigen Trends und einer Chancen- und Risiken-Analyse, erstellt.
- Finanzplanung: Hier werden Umsatz-, Kosten-, Ergebnis- und Investitionspläne für die nächsten fünf Jahre entworfen, wobei drei Jahre detailliert dargestellt werden sollten.
- Berechnung des nachhaltigen Ertrags (auch Cashflow genannt) : Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (BE1) wird um die Ertragsteuern reduziert und ergibt so das Betriebsergebnis vor Zinsen und nach Ertragsteuern (BE2). Hinzugezogen werden Abschreibungen und Investitionen sowie Veränderungen im Nettoumlaufvermögen, um den nachhaltigen Ertrag zu ermitteln.
- Festlegung des Kapitalisierungszinsfußes: Dieser Wert ist entscheidend für den Ertragswert und setzt sich aus einem Basiszinssatz und einem Risikoaufschlag zusammen. Er reflektiert die erwartete Rendite, die ein potenzieller Käufer erzielen könnte. In der Praxis bewegt sich der Kapitalisierungszinsfuß bei KMUs meist zwischen sieben und zehn Prozent.
So wird mithilfe des Ertragswertes der Unternehmenswert ermittelt
1. Beispiel bei einem Kapitalzins von sieben Prozent:
Angenommen, ein Unternehmen erzielt einen stabilen Jahresgewinn von 120.000 Euro. Der aktuelle Inhaber setzt eine Kapitalverzinsung von sieben Prozent an. Er berechnet nun, wie viel Geld ein Käufer anlegen müsste, um bei einer Verzinsung von sieben Prozent 120.000 Euro zu erhalten. Der Unternehmenswert berechnet sich dann aus dem nachhaltigen Ertrag (120.000 Euro) durch sieben Prozent. Das ergibt in diesem Beispiel 1.714,286 Euro. Dies ist der maximal akzeptable Preis, den der Verkäufer dem Käufer abverlangen könnte.
2. Beispiel mit einem Kapitalzins von neun Prozent:
Läge der Kapitalzins desselben Unternehmens bei neun Prozent, wäre es nur noch 1.333.333 Euro wert.
Diese Beispiele zeigen, wie variabel der berechnete Unternehmenswert sein kann. In der Unternehmensbewertung beeinflusst diese Renditeerwartung direkt den Wert des Unternehmens. Ein höherer Kapitalzins (also eine höhere Renditeerwartung) führt in der Regel zu einem niedrigeren Unternehmenswert, da zukünftige Erträge stärker abgezinst werden. Umgekehrt führt ein niedrigerer Kapitalzins zu einem höheren Unternehmenswert.
2. Das EBIT-Verfahren
Das EBIT-Verfahren basiert auf dem betrieblichen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes = EBIT). Es gibt einen groben Überblick über die Profitabilität eines Unternehmens.
Um den Unternehmenswert zu erhalten, wird ganz einfach der EBIT-Wert mit einem branchenspezifischen Faktor (Multiples) multipliziert.
Dabei variiert der Faktor je nach Branche und Marktlage. Für viele KMUs liegt er zwischen 4 und 8.
Beispiel: Ein Unternehmen hat ein EBIT von 200.000 Euro und verwendet einen mittleren Faktor von 6. Das ergibt einen Unternehmenswert von 1,2 Millionen Euro.
3. Das Substanzwertverfahren
Die Substanzwertmethode beleuchtet, wie viel es kosten würde, ein Unternehmen von Grund auf neu aufzubauen. Dabei wird der aktuelle Marktwert von allem, was das Unternehmen besitzt – seien es materielle oder immaterielle Vermögenswerte, ob zwingend für den Betrieb notwendig oder nicht – ermittelt und die Schulden des Unternehmens werden davon abgezogen.
Es gibt zwei Blickwinkel, aus denen man den Wert betrachten kann: den Fortführungswert und den Liquidationswert. Während der Fortführungswert den Betrieb unter der Annahme seiner Weiterführung bewertet, schätzt der Liquidationswert die möglichen Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, wenn das Unternehmen aufgelöst würde.
Der Liquidationswert berücksichtigt insbesondere, welcher Wert bei einem Einzelverkauf der Wirtschaftsgüter erzielt werden könnte. Dieser Ansatz wird meist nur für Betriebe in Betracht gezogen, die nicht mehr profitabel sind. Er repräsentiert den minimalen Wert, den das Unternehmen auf dem Markt haben könnte.
Der Fortführungswert berücksichtigt Aspekte wie den ursprünglichen Kaufpreis der Vermögenswerte, deren Zustand und durchschnittliche Nutzungsdauer sowie die aktuelle Marktnachfrage. Die Bewertung immaterieller Vermögenswerte kann knifflig sein, weshalb oft nur die greifbaren, materiellen Vermögenswerte berücksichtigt werden.
4. Die Marktwertmethode
Die Marktwertmethode ist ein weiteres Verfahren zur Unternehmensbewertung, das auf dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage basiert. Im Kern spiegelt der Marktwert den Gleichgewichtspreis wider, den Käufer bereit sind zu zahlen und Verkäufer zu akzeptieren.
Bei Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, entspricht dieser Wert dem aktuellen Börsenwert.
Für Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, können vergleichbare, börsennotierte Unternehmen oder kürzlich verkaufte Unternehmen derselben Branche und Größe als Orientierung dienen.
Alle vier Methoden der Firmenwertermittlung auf einen Blick
| Bewertungsmethode | Beschreibung | Hauptfaktoren | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Ertragswertverfahren | Wert basiert auf zukünftig erwarteten Erträgen. | Prognose zukünftiger Erträge, Kapitalisierungszinsfuß | Firmenwert bei einem Cashflow von 120.000 € und ein 7 % Kapitalzins: 1.714,286 €; bei 9 % Kapitalzins: 1.333.333 € |
| EBIT-Verfahren | Bewertung basiert auf dem betrieblichen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). | EBIT-Wert, branchenspezifischer Multiplikator (Multiples) | EBIT von 200.000 € x Faktor 6 = Firmenwert von 1,2 Millionen € |
| Substanzwertverfahren | Bewertung basiert auf den Kosten eines Neuaufbaus des Unternehmens minus Schulden. | Marktwert aller Vermögenswerte; Unterscheidung zwischen Fortführungswert und Liquidationswert | – (da dies stark vom Unternehmen abhängt) |
| Marktwertmethode | Wert basiert auf dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. | Gleichgewichtspreis, Börsenwert für gelistete Unternehmen, vergleichbare Unternehmen für nicht gelistete Unternehmen | – (abhängig von der Marktlage und dem Unternehmen) |
Welche Methode ist die beste, um meinen Firmenwert zu ermitteln?
Die Bewertung eines Unternehmens ist komplex und wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Daher gibt es keine „Einheitslösung“ bei der Wahl des richtigen Bewertungsverfahrens.
Wer hilft bei der Unternehmensbewertung?
Institutionen wie Kammern, Banken oder auch Steuer- und Unternehmensberater sowie Wirtschaftsprüfer können Unterstützung bei der Ermittlung des Unternehmenswertes bieten. Es ist entscheidend, bei der Auswahl von externen Beratern sowohl auf deren Erfahrung in der Unternehmensbewertung als auch auf ihre Kenntnisse über die Marktsituation und die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Branche zu achten.
Häufig gestellte Fragen zur Firmenwertberechnung
Es gibt verschiedene Methoden zur Unternehmensbewertung, darunter das Ertragswertverfahren, das EBIT-Verfahren, das Substanzwertverfahren und das Marktwertverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Unternehmens, seiner Branche und anderen spezifischen Faktoren ab.
Während grundlegende Bewertungen selbst durchgeführt werden können, empfiehlt es sich, bei komplexen Bewertungen oder bei großen Entscheidungen, wie einem Unternehmensverkauf, Experten hinzuzuziehen, um eine genaue und objektive Bewertung zu erhalten.
Der Kapitalzins spiegelt die erwartete Rendite wider, die ein Käufer auf sein investiertes Kapital erhalten möchte. Ein höherer Kapitalzins weist oft auf ein höheres Risiko oder eine höhere Renditeerwartung hin, während ein niedrigerer Zinssatz auf geringere Renditeerwartungen oder Risiken hinweist.