Buchrezension: Die etwas andere Politik – Buchempfehlungen zum Wahlkampf
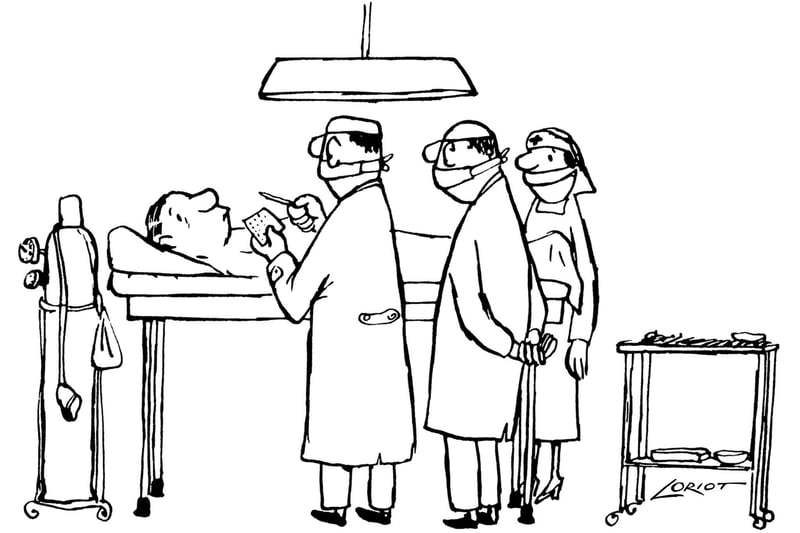
„Wer als Patient eine korrekte Beendigung der Operation anstrebt, wird Ihnen die Unterschrift nicht versagen. Hier ist jedoch die Mitarbeit gleichgesinnter Ärzte unerlässlich.“
Arztvisite. Drei „Götter in Weiß“ beugen sich über den Patienten und fragen: „Wo tut’s denn weh?“ Sie sprechen behutsam und abgeklärt, werfen sich aber auch sorgenvolle Blicke zu. In ihrer Mappe sind Röntgenbilder und Belastungs-EKGs. Sie vermuten einen Befund, aus dem sich eine Therapie ergeben könnte. „Kopf hoch! Das wird schon. Wir machen Fortschritte.“
Patient ist die Bundesrepublik Deutschland. Drei kluge Spezialisten legen ihre Bücher auf den Tisch, angenehm lesbar, gut recherchiert. Jedes mit zuversichtlicher Sorge erdacht und mit Aufwand und Aufwind geschrieben.
Alle drei geben sich sicher: Die neue Welt ist nicht mehr die alte. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Plattentektonik der politischen Landschaft verschoben. Konstanten von gestern sind Variablen von heute. Konkret: Den klassischen Parteien kamen gewohnte Milieus abhanden, neue wurden lange nicht erkannt.
Globale Herausforderungen stehen „plötzlich“ vor der Wohnungstür. Das gewohnte Räderwerk des Politikbetriebs knirscht und knackt. Chancen und Risiken werden neu definiert und verteilt. Es ist Zeit – nicht für neue Gedanken, sondern für neues Denken.
So sieht es auch Michael Koß in seinem Buch „Demokratie ohne Mehrheit?“. Der Autor ist vergleichender Politikwissenschaftler. Er hat entdeckt, dass „Fragen des politischen Wettbewerbs, der Parteien, der Parlamente und somit der Demokratie heute keine rein technischen mehr sind, „sondern mit neuem (altem?) Furor ausgetragen werden“.

Wenn die Leidenschaften aufschäumen, bedarf es kühler Analyse. Koß arbeitet mit systemischer Disziplin. Er fragt nach Strukturen und Konfliktlinien der Mehrheitsfindung. Es ist ja erst der dritte Versuch der Deutschen mit der Demokratie.
Solange sie ihren Verstand – und damit die erkämpfte Freiheit – nicht an der Garderobe eines „repräsentativen Diktators“ oder einer ideologischen Selbstblockade abgeben wollen, wird es Parteien brauchen. Sie sind die beste aller schlechten Möglichkeiten, diffuse Meinungen und Konflikte zu bündeln und nach einem parlamentarischen Prozess in Gesetze zu gießen.
Dabei geht es nicht um das „gelobte Land, wo Milch und Honig fließen“, sondern um Entscheidungen. Keine ist alternativlos. Die Probleme lassen sich nicht kompostieren, und jede heutige Wahrheit ist der Irrtum von morgen.
Aber werden und müssen es die klassischen Volksparteien sein? Können sie es überhaupt, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, in der Grüppchengesellschaft Gemeinsamkeiten zu finden, also vergangener politischen Kultur anhaften?
Koß ist überzeugt: Volksparteien sind nicht der Normalzustand. Sie brauchen eine Bedrohung von außen, um die breite Mitte zu erobern und Experimente an die Ränder zu drängen. Union und SPD seligen Angedenkens waren Burgfrieden. Der Kalte Krieg ließ den Ausnahmezustand als normal erscheinen. Normal war vorher und ist es heute wieder: „entgrenzter Wettbewerb“, gesellschaftliche und parteipolitische Fragmentierung und Polarisierung.
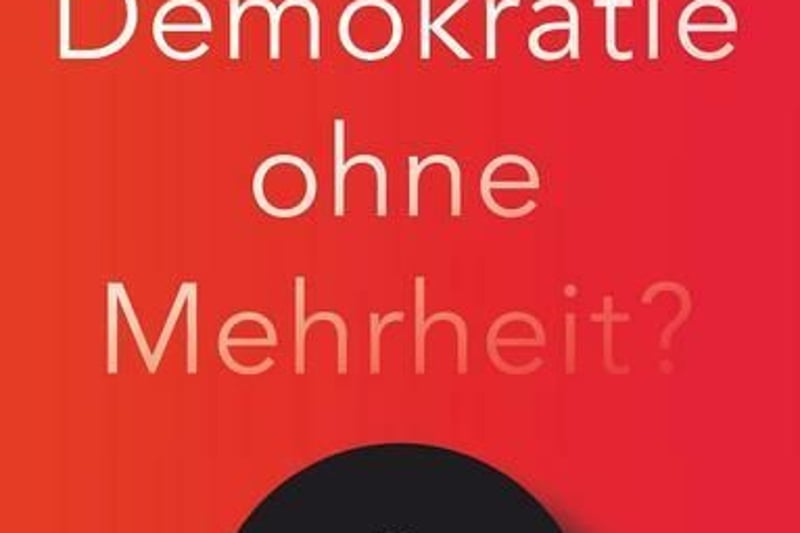
In dieses System der geregelten Konflikte grätschen gelegentlich charismatische Einzelgänger und Narzissten. Sie fegen die Akten vom Tisch und erzeugen Bewusstseinsschübe, sind aber nicht die Lichtgestalt, an der man sich nachhaltig orientieren kann. Koß nennt sie die „Renegaten“. Sie attackieren oder umgehen das Dogma, aber: „Hinter ihnen schlagen die Sträuche zusammen. Das Gras steht wieder auf“, wie schon Goethe schrieb.
Koß schließt mit einem kleinen Katechismus für Demokraten. Alle Reformvorschläge haben nämlich eines gemeinsam: Sie realisieren sich nicht von selbst. Demokratie ist ein Prozess, kein Zustand. Sie braucht Menschen, die sie mit Leben füllen.
Genau dort setzen Hanno Burmester und Clemens Holtmann mit ihrem Buch „Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt“ an. Auch hier geht es um das Thema „Partei“, nun aber nicht um historische Verläufe oder Institutionenkunde.
Die Autoren sehen die Welt als „Wille und Vorstellung“. Sie beobachten: Junge Leute, die in eine Partei eintreten, haben etwas vor, mit sich, mit ihrem Land, vielleicht mit der Welt. Sie wollen nicht jahrelang Flyer verteilen und Würstchen wenden. Das Schlimmste, was man ihnen, der Partei und der Allgemeinheit antun kann, ist, ihren Elan auszubremsen und ihre Talente nicht abzurufen.
Und so ist die Vision der Partei, die die Autoren entwerfen, keine Stufenpyramide, sondern ein pulsierendes Feld aus interagierenden Gruppen. Jede davon kennt den allgemeinen und ihren eigenen Daseinszweck („purpose“). Jede ist ergebnisorientiert an der Arbeit. Es geht nicht um Amt und Würde, sondern um Skills und Bereitschaft. – Dieses pfiffige Buch als Empfangsgeschenk für jeden Neuling im Ortsverein. Das wäre was!

Schließlich lohnt es immer, den Gedankenfilz eines Fachbereichs mit den Methoden und Werkzeugen eines ganz anderen zu vertikutieren. Da fällt manche Schuppe von den Augen. Dass dem Wohl und Wehe der Politik in ihren Tiefenschichten prähistorische Verhaltensmuster zugrunde liegen, ist den Humanwissenschaften eine längst vertraute Tatsache.
Hier setzt Hans-Otto Thomashoff mit seinem Buch „Mehr Hirn in die Politik“ an. Da belehrt uns kein Politologe oder Historiker, sondern ein anerkannter Neurologe und Hirnforscher über die Ursachen von Politikversagen und -verdruss.
Was läuft falsch? Wir ignorieren die Regeln, nach denen unser Hirn arbeitet. Wir rackern uns ab im Hamsterrad. Wir vergeuden Kraft, erzeugen Kurzschlüsse, erschöpfen uns in Aktionismus und sind unfähig, die Logik der Probleme mit der Logik unseres Verstandes zu koordinieren. Das Ergebnis ist ein kräftezehrender Vielfrontenkrieg, in dem immer nur der „gegebene Anlass“ regiert, und langfristige Perspektiven keine Chance haben.
Wir alle haben das gleiche Hirn
Gewiss. Man kann fidel und ahnungslos Karriere machen. Man fährt halt „auf Sicht“ und per Versuch und Irrtum. Irgendwann dient die „Maßnahmerei“ nur noch dem parteipolitischen Machterhalt. Das Wahlvolk jedoch kann dem Unterricht nicht mehr folgen. Es fühlt sich düpiert, ignoriert und in seinen Rechten entmündigt. Die Probleme bleiben liegen und werden an die nächsten Generationen delegiert.
Nicht das flach wurzelnde Geplänkel der Talkshows bringt uns weiter, sondern das uralte „Erkenne dich selbst!“ vom Apollotempel in Delphi. Da die meisten Probleme in unserem Hirn entstehen, bieten Neurobiologie und Psychologie Lösungen, die ihnen buchstäblich gewachsen sind.
Thomashoff vermeidet ein plattes Politiker-Bashing. Wir alle nämlich haben das gleiche Hirn. Im Privatbereich, am Arbeitsplatz, im Verein. Überall gilt: Wer die natürlichen Grundbedürfnisse missachtet, die unser Handeln leiten, erzeugt Kurzschluss und Missbehagen. Und wer aus Bequemlichkeit wichtige Kompetenzen an den Staat verschleudert, darf sich über dessen wachsende Machtfülle nicht beschweren.
Nun ist das keine grundstürzende Erkenntnis. Vom Trojanischen Pferd bis Watergate und Golfkrieg: Die Torheit der Mächtigen ist unkaputtbar und eine Konstante der Weltpolitik. Wie kein anderes Wesen sind wir befähigt, unsere Lebensbedingungen zu gestalten, aber auch hochbegabt, gegen die eigenen Interessen zu handeln, wenn wir Affekten wie Gier, Eitelkeit, Hass und Herdentrieb das Steuer überlassen.

Gefühle lassen sich nicht verbieten, man kann aber ihre Ursachen erforschen und sie mit Fakten konfrontieren. Schlüsselwort des Buchs ist „Erwachsenwerden“. Es gelingt nur, wenn vier psychische Grunddaseinsbedürfnisse gesichert sind.
Wo sie fehlen, ist das Wohlbefinden gestört und der Zusammenbruch des Systems vorprogrammiert: Bindung in verlässlicher Gemeinschaft. Selbstwirksamkeit und Entfaltungsfreiheit. Stressbegrenzung durch Sicherheit und Gerechtigkeit. Stimmigkeit, das heißt Kongruenz von Realität und Wahrnehmung.
Wo sich Gefühl und Verstand in die Quere kommen, verliert zumeist der Verstand, schon weil er – wenn überhaupt – langsamer arbeitet. Das Gefühl (Stammhirn) setzt immer schon Handlungsimpulse, wenn die logische Vernunft (Großhirn) noch längst nicht in die Puschen kommt. Gegen die Mechanismen der Gefühlswelt hat es die Welt der Fakten schwer.


Affekte verstärken sich, selbst wenn man sie argumentativ ins Unrecht setzt. Erwachsene fallen zurück in kindliche Verhaltensmuster (Regression). Der geübte Demagoge setzt nicht auf Inhalte, sondern auf emotionale Überrumpelung. Er schmeichelt seinen Zuhörern, verschmelzt sie in der Masse, spaltet sie in die Guten und die Bösen und zeigt ihnen den Sündenbock.
„Mehr Hirn in die Politik“ ist ein erfrischendes Buch. Es trägt eine Fülle von Beobachtungen und Erkenntnissen zusammen. Wer das ungute Gefühl sublimieren kann, ständig mit sich selbst ertappt zu werden, dem ist es Lebenshilfe und Training fürs menschliche Reifezeugnis.
Mehr: In 90 Minuten um die Welt: Kanzlerkandidaten streiten über Mali, China und Orbán.





