Wahljahr: K(l)eine Revolution: Wie sähe eine Regierungspolitik der Grünen aus?

Pochen auf Eigenständigkeit.
Berlin. Dreist, naiv oder selbstbewusst? Die Parteivorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, formulieren einen Führungsanspruch für Deutschland. Nach den für ihre Partei erfolgreichen Landtagswahlen vom vergangenen Wochenende berechtigter denn je.
Vieles spricht dafür, dass die Grünen nach fast 16 Jahren auf der Oppositionsbank wieder der nächsten Bundesregierung angehören. Bleiben die Umfragen wie bisher, treten sie erstmals bei einer Bundestagswahl als zweitstärkste Kraft nach der Union an.
1998 war die frühere Protestpartei mit 6,7 Prozent in die Regierung gekommen. Damit konnten sie in der von der SPD geführten Koalition drei Ressorts herausverhandeln. Die SPD war Koch, die Grünen Kellner. Heute, mit stabilen Umfragewerten um 20 Prozent, wollen die Grünen selber Koch werden.
Was würde sich ändern in der Republik, wenn sie – derart gestärkt – im Herbst auf die Regierungsbank wechseln würden, gar vielleicht den Kanzler stellen könnten? Diese Frage versuchen zwei Bücher aktuell zu klären. Das eine kommt vom Parteivorsitzenden Robert Habeck persönlich, das andere hat der Journalist Ulrich Schulte geschrieben.
„Von hier an anders“ titelt Habeck verheißungsvoll. Er will bewusst anders sein als andere Politgrößen. Das macht sich nicht nur an seinem Äußeren fest, schließlich kommt er stets eine Spur legerer daher als andere Parteivorsitzende. Das ist für ihn vor allem auch eine Frage der inneren Einstellung. Das Schreiben an dem Buch habe ihm klargemacht, worum es geht: dass Politik kein Spiel um Mehrheiten ist, sondern „das Privileg, in seiner Zeit einen Unterschied machen zu können“.
Empfehlenswert ist das Buch, vor allem die persönlichen Abschnitte, in denen Habeck beschreibt, wie er anfangs mit seiner neuen Rolle als Parteichef haderte, nachdem er zuvor sechs Jahre lang in Schleswig-Holstein Minister für „Energie, Umwelt, Landwirtschaft, ländliche Räume, Digitalisierung, Atomkraft, Küstenschutz, Meeresschutz, Fischerei, Verbraucherschutz, Wälder, Moore, Strände, Jagd, Tierschutz, Artenschutz“ gewesen war. Also irgendwie für alles.

„Alles war konkret“, schreibt der 51-Jährige. Mit jeder Unterschrift, die er unter ein Gesetz oder eine Verordnung setzte, habe sich die Wirklichkeit verändert. „Ich lernte, was Verantwortung bedeutete. Und mir bedeutet sie viel.“
Habeck, der die Partei zusammen mit Annalena Baerbock seit Anfang 2018 führt, versucht nachzuvollziehen, „was in der Gesellschaft in den letzten Jahren passiert ist und was mit meiner Partei“. Und was aber auch mit ihm. Er gibt Einblicke in seine Gedanken, aber auch in Zweifel und Selbstkritik.
Inzwischen habe er jedoch seinen Frieden mit seinem Wechsel in die Bundespolitik gemacht, und natürlich hofft er jetzt darauf, dass den Grünen wieder Regierungsmacht anvertraut wird. „Um diese Macht zu kämpfen, wird die Aufgabe der nächsten Monate sein.“
Die blinden Flecken der Politik
Die Grünen wollen Orientierungspartei sein, zuständig für das große Ganze – und Habeck tastet sich an die blinden Flecken der Politik der letzten Jahrzehnte und ihre Widersprüche heran, widersteht aber der Gelegenheit, sich am politischen Gegner abzuarbeiten. Auch mit wem die Grünen am liebsten koalieren würden oder ob er oder Co-Chefin Baerbock Kanzlerkandidat wird, erfährt der Leser nicht.
Die Grünen entwerfen eine Politik, die nicht auf Sicht fahren und nur reparieren will. Nahezu alle Politikbereiche dekliniert Habeck durch, angefangen bei der Klimapolitik über Bildung, Digitalisierung bis Sicherheit. Nicht immer hat der studierte Philosoph eine Antwort bereits parat, die Suche nach selbiger treibt ihn an.
„Wie findet eine Gesellschaft unter den Bedingungen von Freiheit und Demokratie zu einer Gemeinsamkeit, die es ihr ermöglicht, die notwendigen Schritte zu gehen?“, fragt Habeck. „Welches sind die Kräfte und Dynamiken, die Lösungen und gemeinsamen Fortschritt blockieren?“
Was Habeck damit meint, auch darüber gibt das Buch Aufschluss, etwa in dem Kapitel über „hyperglobalisierten Kapitalismus“, dem er neue Regeln geben will. Ordnungsrecht muss sein, etwa ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika oder Effizienzquoten beziehungsweise Minderungsvorgaben für den CO2- oder Stickstoffausstoß bei Autos sowie Mindestvorgaben bei der Nutztierhaltung.
Besser wäre es aber, schreibt Habeck, wenn die Systeme selbst nachhaltig arbeiten könnten, etwa durch einen „hoch genug angesetzten Preis für CO2, der den Verbrauch fossiler Energie unattraktiv macht“. Den Kapitalismus „ökologisch bändigen“ – darum geht es ihm.
Konkreter wird es dann erst im Programm zur Bundestagswahl werden. Den ersten Entwurf will die Partei an diesem Freitag vorstellen. Der Teil zur Wirtschaftspolitik, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, gibt erste Einblicke. Von Wirtschaftsfeindlichkeit keine Spur, im Gegenteil. Viel Unterstützung soll es geben auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.
Image der Grünen: Radikalste Instanz in Sachen Klimaschutz
Wer glaubt, dass die Grünen alles auf den Kopf stellen könnten, dem sei Ulrich Schultes Buch „Die grüne Macht – Wie die Ökopartei das Land verändern will“ empfohlen. Schulte, Journalist der „tageszeitung“, hält die These, die Grünen planten eine Art Ökodiktatur, für heillos übertrieben.
Auf 239 Seiten beschreibt Schulte die Partei und ihre beiden Vorsitzenden wohlwollend, aber kritisch. Sein Fazit: Kämen die Grünen an die Macht, dann würde sich ziemlich wenig ändern. Die Grünen verträten eine ökologische Politik „mit Maß und Mitte“, sie gäben sich offen für Neues, wollten aber auch nicht zu viel Veränderung. Alles in allem setzten die Grünen auf konservative, wenig inspirierte Politik und nicht auf Systemveränderung.
Warum trotzdem so viele denken, dass die Grünen radikale Antworten bieten? Eine Erklärung Schultes ist: weil die Bilanz der Großen Koalition beim Klimaschutz „mehr als dürftig“ ist. Die Grünen gelten als die radikalste Instanz in Sachen Klimaschutz. Lange reagierte die Mehrheit der Gesellschaft geradezu aggressiv auf grüne Programmatik. Unions- und FDP-Politiker verbannen die Grünen noch heute gerne als Verbotsfanatiker oder Ökodogmatiker in die linke Ecke.
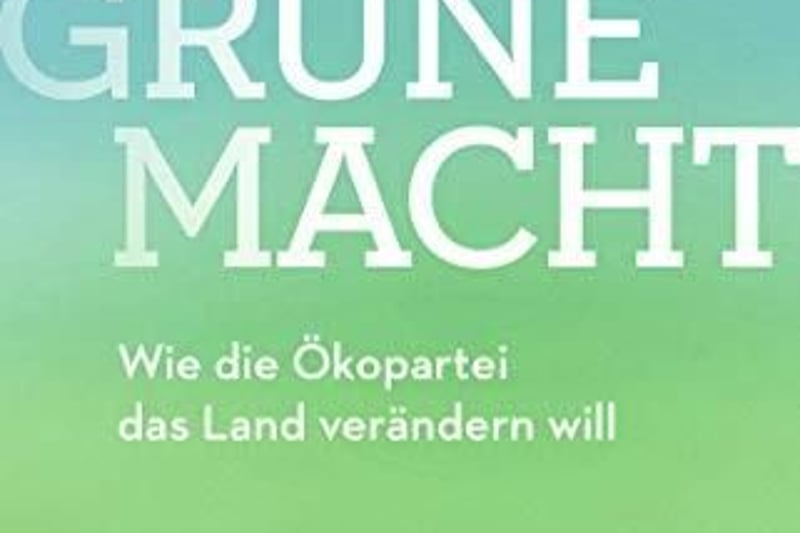
Ja, die Grünen wollten mehr untersagen als zum Beispiel die Union, die den Status quo beibehalten wolle, schreibt Schulte. Für eine ökologischere Wirtschaft, für einen klimaneutralen Verkehrssektor oder eine grüne Agrarwende gäbe es neuen Regelungsbedarf. Fleisch würde teurer werden, weil die Grünen perspektivisch das Ende der industriellen Massentierhaltung anstreben. Mehr Platz für Schweine, mehr Tierwohl, das bedeute mehr Kosten. Aber verboten würde nichts. „Jede und jeder sollen weiterhin so viele Schnitzel essen, wie er oder sie mag.“
Grünen-Politik: kein Spiel um Mehrheiten
Doch wie schnell sie wieder zum Feindbild werden, zeigte jüngst die Debatte um der Deutschen Eigenheim. Die Grünen äußerten sich skeptisch zu Einfamilienhäusern auf immer neuen Grundstücken auf der grünen Wiese, aber sie forderten kein Verbot. Eingriffe in den persönlichen Lebensstil sind für die Grünen tabu, seit sie mit ihrem Veggieday, einem fleischfreien Tag in Kantinen, im Bundestagswahlkampf 2013 negative Erfahrungen machten. Trotzdem kam der alte Vorwurf wieder hoch.
Lange waren sie ein Anhängsel der SPD. Jetzt pochen sie auf Eigenständigkeit, was Nachteil habe, schreibt Schulte: „Wer die Grünen wegen linker Ideen wie der Bürgerversicherung, der Abschaffung von Hartz IV oder des Ehegattensplittings unterstützt, muss damit leben, dass Schwarz-Grün nach einer Bundestagswahl nichts davon umsetzt.“
Umgekehrt müssten sich Ökologie-affine Konservative mit dem Risiko eines Mitte-links-Bündnisses abfinden. Wer bei den Grünen sein Kreuz macht, kaufe im Grunde, konstatiert Schulte, eine „politische Überraschungstüte“. Jetzt, nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ist noch die Möglichkeit einer Ampelkoalition hinzugekommen, also eines Bündnisses mit SPD und FDP.
In Wahrheit ist die Politik der Grünen ziemlich berechnend. Sie regieren in elf Bundesländern, in allen nur denkbaren Koalitionen. Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, Schwarz-Grün in Hessen, Schwarz-Grün-Gelb in Schleswig-Holstein, Schwarz-Rot-Grün in Sachsen und Sachsen-Anhalt, Rot-Rot-Grün in Thüringen und Berlin.
Und auch wenn die Grünen nicht in jedem Bundesland einen so wirtschaftsfreundlichen Kurs fahren wie in Baden-Württemberg, wo der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann gerade mit 32,6 Prozent ein neues Rekordergebnis eingefahren hat, sind die Grünen weniger radikal, als sie häufig dargestellt werden.
Ein Linksbündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei auf Bundesebene hält Schulte wie auch andere Beobachter für unrealistisch. Es habe, selbst wenn es eine Mehrheit gäbe, zu viele Sollbruchstellen, die Grünen wüssten das. Auch Habeck selbst schreibt, einem solchen Bündnis fehle die „gesellschaftliche Mehrheit“.
Manche stoßen Sprache und Politik der Grünen ab, andere sind angetan. Journalist Schulte hält vieles, was Habeck und Baerbock in der deutschen Politik etabliert haben, für zukunftstauglich: etwa die Weigerung, Mitbewerber herabzusetzen und permanent herumzumäkeln.
Oder den Versuch, eine mehrheitsfähige, in alle Milieus ausgreifende Kraft aufzubauen. „Vielleicht ist der einladende Gestus, der auf die ganze Gesellschaft zielt, ihr wichtigstes Verdienst. Weg von der Besserwisserei, hin zur Akzeptanz von Widersprüchlichkeit.“






„Sie fordern die Union im Kampf um Platz eins im deutschen Parteiensystem heraus“, schreibt Schulte. „Wer das vor ein paar Jahren vorhergesagt hätte, wäre ausgelacht worden.“
Mehr: Bundesregierung ohne Union? Die Grünen könnten Deutschlands Machtbalance ändern.





