Gastkommentar: Warum Scholz um Vertrauen bittet, das er gar nicht erwartet
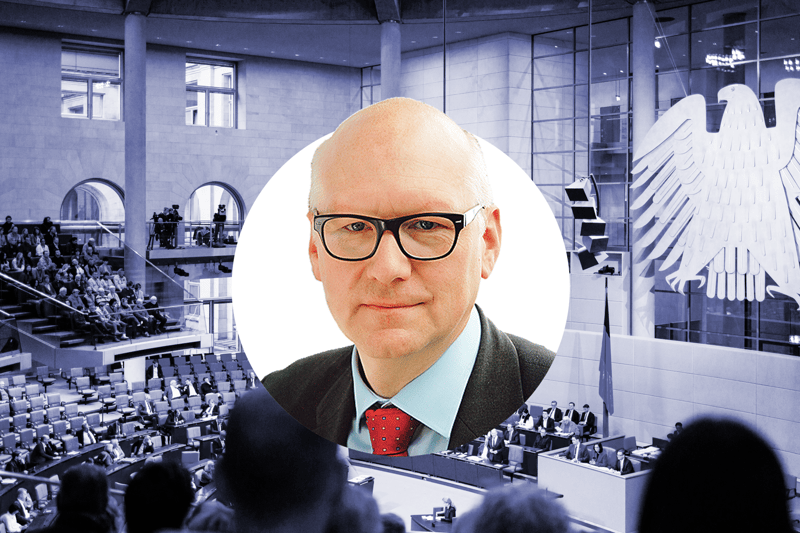
Die Vertrauensfrage, die Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember im Bundestag stellen wird, ist ein Beispiel, wie Lehren aus der Geschichte wirken können. Weil die Weimarer Republik auch daran scheiterte, dass eine Auflösung des Parlaments und der Sturz des Reichskanzlers so einfach waren, bauten die Mütter und Väter des Grundgesetzes konsequente Hürden gegen mögliche Wiederholungen.
Sie wollten verhindern, dass destruktive Kräfte in Politik und Parlament Regierungen zerstören und Parlamente arbeitsunfähig machen. Auch der Bundespräsident erhielt deutlich weniger Möglichkeiten zum aktiven Eingriff, als sie die Weimarer Reichspräsidenten per Verfassung besaßen. Es war bekanntlich Reichspräsident Hindenburg, der Hitler 1933 die Macht im Staat freigab.
Destruktive antidemokratische Kräfte gab und gibt es in allen Gesellschaften. Deshalb gilt heute: Wer einen Bundeskanzler via Parlament loswerden will, muss einen anderen an seine Stelle setzen. Wer stürzen will, muss einen realistischen Vorschlag machen, wie es weitergeht.
„Konstruktiv“ nennen wir deshalb das Instrument des Misstrauensvotums im Grundgesetz. Rainer Barzels Versuch gegen Willy Brandt scheiterte bekanntlich im April 1972.
Helmut Kohl dagegen konnte am 1. Oktober 1982 auf diesem Weg Helmut Schmidt aus dem Kanzleramt entfernen. Aber nur, weil die FDP die Seiten gewechselt hatte. Kohls Legitimität wurde bezweifelt, weil die FDP in den Wahlen 1980 noch anderes versprochen hatte. Deshalb instrumentalisierte Kohl am 13. Dezember 1982 die Vertrauensfrage, um das Parlament auflösen und mit Neuwahlen eine eigene Mehrheit erhalten zu können.
Die Vertrauensfrage dient heute als Weg zu Neuwahlen
Heraus kam eine doppelte Legitimität: Kohl gewann seine eigene Mehrheit. Und die bewusst zur Parlamentsauflösung gestellte Vertrauensfrage erwies sich als plausibler Hebel für den Weg zu dieser neuen Legitimität. Das Ergebnis zeigte die neuen realen Meinungsverhältnisse im Wahlvolk.
Gerhard Schröder hatte 2005 dasselbe Ziel. Aber er verzockte sich, als er nach der verlorenen NRW-Landtagswahl im Mai meinte, durch das Instrument der Vertrauensfrage zur Bundestagsauflösung eine neue Mehrheit erreichen zu können.
Die Wähler entschieden bekanntlich äußerst knapp für Angela Merkel, und der Testosteron-Auftritt des Verlierers Schröder in der Fernseh-Elefantenrunde offenbarte den Schmerz seines politischen Misskalküls.
» Lesen Sie auch: Die Vertrauensfrage des Robert Habeck
Aus dem ursprünglichen Geist der Vertrauensfrage – sich der Gefolgschaft zu versichern – hat sich historisch-praktisch ein neuer Sinn entwickelt: Klarheit zu schaffen über die realen Macht- und Mehrheitsverhältnisse durch die Öffnung des Wegs zu einer aktuellen Wahlentscheidung.
Das ist auch der Sinn des Verfahrens am 16. Dezember. Olaf Scholz hat keine Mehrheit im Parlament. Er hat „die Handlungsfähigkeit einer parlamentarisch verankerten Bundesregierung verloren“, wie es in der einschlägigen Formulierung des Bundesverfassungsgerichts zur Bewertung der Vertrauensfrage heißt.
Deshalb ist das Instrument der Vertrauensfrage nicht nur legitim, sondern sinnfällig und politisch adäquat, um eine handlungsfähige Mehrheit entlang der aktuellen Wählermeinung zu erhalten.
Sollte die AfD für Scholz stimmen, wäre das destruktive Heuchelei
Die öffentliche Diskussion über das Verfahren ist seit Wochen so intensiv, dass es jedem mündigen Bürger, jeder interessierten Bürgerin transparent und zugänglich ist. Es gibt nichts zu deuteln an Absicht und Zielen. Wer so tut, als sei das nicht so, der will offensichtlich etwas anderes.
Wenn nun einige AfD-Politiker darüber sprechen, Olaf Scholz ihr Vertrauen aussprechen zu wollen, ist diese Pseudo-Zustimmung eine destruktive Heuchelei. Wer als AfD-Abgeordneter für Olaf Scholz stimmt – und ihm damit eine sonst nicht verfügbare Mehrheit sichern möchte, um Neuwahlen zu verhindern –, zielt offensichtlich darauf, den Geist des transparenten Verfahrens zu zerstören. Das wissen auch die AfDler, die sich damit bewusst als Pseudo-Demokraten präsentieren.
Wir sehen eine vermeintliche Cleverness mit dem Gesicht aufgesetzter Unschuld aus der Verachtung demokratischer Erfahrungsregeln. Wer das gutheißt oder schulterzuckend meint, das sei doch nur ein parlamentarisches Spiel, der offenbart vor allem seinen Zynismus gegen den Geist und die Regeln zivilisierter demokratischer Prozesse.
Demokratische Verfahren benötigen auch moralische Regeln. In der Sprache, im Umgang, im Verhalten zueinander. Parlamentarische Regeln und demokratische Prozesse gegen den bewussten Zynismus jener zu verteidigen, die das politische System diskreditieren möchten, ist folglich eine historisch lernbare Herausforderung, die sich täglich neu stellt.






Wer diese historischen Erfahrungen ignoriert, darf sich nicht wundern, wenn er eines Tages außerhalb der Demokratie aufwacht.
Der Autor: Magnus Brechtken ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin.
Mehr: „Brutales Geschäft“ – Wie Werbeagenturen Politikern zur Kanzlerschaft verhelfen





