Der Chefökonom – Kommentar: Gute Gesundheitspolitik ist mehr als der Kampf gegen Coronaviren

Bislang war der Engpass die Versorgung der Schwerkranken.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist für viele so etwas wie das eigene schlechte Pandemiegewissen. Der SPD-Politiker und habilitierte Epidemiologe nervt so manchen Menschen mit seinen Mahnungen zur Vorsicht im Umgang mit dem Coronavirus – aber behielt in der Vergangenheit mit seinen düsteren Prognosen meist recht. Mutmaßlich hat ihm dies zum Ministeramt verholfen.
Nun kann man es als lobenswert erachten, wenn ein Gesundheitsminister seine Nächte damit verbringt, wissenschaftliche Studien zu lesen, die sonst nur von Forschern und Fachreferenten in Ministerien ausgewertet werden.
Sträflich wäre es jedoch, wenn dem obersten Gesundheitspolitiker dabei der Blick für die Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitssystems verloren ginge. Denn gemessen an den Herausforderungen, vor denen die Gesundheitspolitik in Deutschland steht, ist die Pandemie sicher nicht das größte Problem.
Fakt ist: Die Gesundheitskosten laufen aus dem Ruder, und zwar nicht wegen, sondern trotz Corona. Im zurückliegenden Jahrzehnt stiegen die Ausgaben jahresdurchschnittlich um 4,2 Prozent, die Einnahmen dagegen nur um 3,5 Prozent.
Denn während der Pandemie wurden zahlreiche nicht lebensnotwendige Operationen sowie anschließende Rehabilitationsmaßnahmen verschoben, was zumindest kurzfristig Kosten sparte. Manche Klinik und Facharztpraxis musste auf dem Höhepunkt der Pandemie sogar Kurzarbeit anmelden.
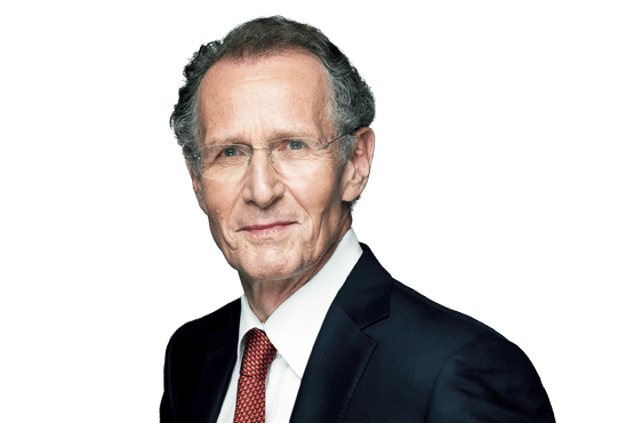
Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com.
Maßnahmen beschränken sich darauf, frühere Kostensteigerungen aufzufangen
Um das absehbare Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im kommenden Jahr aufzufangen, welches das Gesundheitsministerium auf voraussichtlich 17 Milliarden Euro beziffert, plant der Gesundheitsminister nun neben einer Beitragserhöhung Einschnitte für die Pharmaindustrie und eine Aufstockung des Bundeszuschusses.
Zudem sollen die Vergütungen für Zahnärzte und Ärzte und die Ausgaben der Krankenhäuser begrenzt werden. „Ohne zusätzliche Maßnahmen würde der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV im Jahr 2023 von derzeit 1,3 Prozent um rund einen Prozentpunkt steigen und anschließend aufgrund der Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben jedes Jahr um weitere 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte zunehmen“, heißt es im Gesetzentwurf des Ministeriums.
Nun kann man über jede dieser Maßnahmen trefflich streiten. Unstrittig ist jedoch, dass die seit Langem bekannten strukturellen Defizite im Gesundheitssystem damit nicht angegangen werden – wieder einmal nicht!
>> Lesen Sie hier: Lauterbach bringt Krankenkassenbeiträge in Rekordhöhe auf den Weg – und kippt Pharma-Soli
Letztlich beschränken sich Lauterbachs Maßnahmen darauf, die Kostensteigerungen aufzufangen, welche durch die Leistungsausweitungen seines Amtsvorgängers Jens Spahn (CDU) verursacht und seinerzeit von ihm selbst unterstützt wurden.
Tatsächlich müsste ein weitsichtig agierender Gesundheitsminister dickere Bretter bohren, um unser Gesundheitssystem auf die Folgen des bald einsetzenden Alterungsschubs vorzubereiten. Es ist absehbar, dass die wichtigste Einnahmenbasis der GKV, die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme, erodiert, wenn demografisch bedingt die Erwerbstätigkeit sinkt.

Der SPD-Politiker und habilitierte Epidemiologe behielt in der Vergangenheit mit seinen düsteren Prognosen meist recht.
Überdies wird der kostentreibende Fachkräftemangel vor dem Gesundheitssektor nicht haltmachen. Zudem dürfte der Alterungsschub im Zusammenwirken mit dem medizinischen Fortschritt zu einem Kostenturbo werden.
Engpass bei Versorgung der Kranken
Ohne einen markanten Effizienzschub lassen sich diese seit Langem bekannten Herausforderungen nicht bewältigen. Gerade in der stationären Versorgung, die ein Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben ausmacht, ist das Effizienzpotenzial enorm.

Es müssen jetzt die Folgen der Leistungssteigerungen, die Spahn als Gesundheitsminister verursacht hat, aufgefangen werden.
Der wohl wichtigste Grund: Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über zu viele Krankenhäuser, die oft klein und vor allem schlecht ausgestattet sind. So fehlten auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht etwa Krankenhausbetten; der Engpass war die Versorgung der Schwerkranken.
Der Fehler liegt im System: Seit 1972 sind die Bundesländer für die Kapazitätsplanung und Finanzierung der Investitionen der Krankenhäuser zuständig und die Krankenkassen für die der Behandlungskosten.
Dass mit dieser dualen Finanzierung Ineffizienzen verbunden sind, ist hinlänglich belegt. Eine Folge ist, dass das deutsche Gesundheitssystem pro Einwohner etwa 6500 US-Dollar absorbiert, während das zentralisierte dänische System mit rund 1000 Dollar weniger auskommt, wie Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen.
Unter Gesundheitsökonomen ist es unstrittig, dass eine Finanzierung der Krankenhäuser aus einer Hand, die der Krankenkassen, eine überlegene Lösung wäre. Etwa 60 Prozent der Kliniken arbeiten dieses Jahr defizitär, kommendes Jahr womöglich gar 80 Prozent, wie die Krankenhausgesellschaft warnt.
>> Lesen Sie hier: Neue Eskalation bei Sozialbeiträgen – Das kommt auf die Beitragszahler zu
Würden die Gelder der Bundesländer über den Gesundheitsfonds an die Kassen fließen, könnte die Krankenhauslandschaft bedarfsorientierter, wirtschaftlicher und losgelöst von Bundesländergrenzen organisiert werden. Im Klartext heißt dies freilich, dass unrentable und unzulänglich ausgestattete Krankenhäuser fusionieren oder schließen müssten.
Viel ist nicht unbedingt gut
Derzeit gibt es laut Statistischem Bundesamt 1903 Krankenhäuser, die je 100.000 Einwohner 587 Betten vorhalten. Jeder Deutsche könnte also jährlich 2,1 Tage in einem Krankenhausbett verbringen, dreimal so viele wie ein Däne. In keinem anderen OECD-Land gibt es so viele stationäre Krankenhausaufenthalte wie in Deutschland.

Es fehlten auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht etwa Krankenhausbetten; der Engpass war die Versorgung der Schwerkranken.
Doch viel ist eben nicht unbedingt gut. Dass in zahlreichen der nicht oder nur wenig spezialisierten Häuser Routine und Fachkompetenz bei komplizierten Operationen fehlen, ist unstrittig. So ist es erwiesen, dass das Sterblichkeitsrisiko bei den meisten Eingriffen umso geringer ist, je häufiger sie in einer Klinik durchgeführt werden. Eine geringe Operationsroutine bedingt nun einmal relevante Risiken für Menschenleben.
Hinzu kommen gravierende Defizite in der Notfallversorgung. Von den 2062 Standorten der allgemeinen Krankenhäuser nehmen nur 1127 an der allgemeinen Notfallversorgung teil.
An rund 40 Prozent der Standorte gibt es keine Notfallversorgung. Es ist ein Irrglaube, dass im Notfall die Nähe zum Krankenhaus der allein entscheidende Faktor für die Überlebenswahrscheinlichkeit ist. Wenngleich Schlaganfall und Herzinfarkt zeitkritisch sind, so versterben nur sehr wenige Patienten im Notarztwagen.
Wichtiger ist, dass jede Klinik in der Lage sein sollte, Notfallpatienten bestmöglich zu versorgen. Je größer und damit spezialisierter ein Krankenhaus ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einer lebensgefährlichen Erkrankung nicht zu erliegen.
Reformen notwendig
Klar ist, dass jede Konsolidierung der Krankenhauslandschaft Proteste in der Bevölkerung auslöst. Daher scheuen insbesondere Lokalpolitiker solche unpopulären Maßnahmen. Dieser verständliche Widerstand könnte ein Stück weit durch die Aufstockung des Krankenhausstrukturfonds abgefedert werden.
Lesen Sie hier mehr zur Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung
Mit diesem Geld könnten die verbleibenden Kliniken restrukturiert und modernisiert werden, wenn gleichzeitig unter Versorgungsaspekten weniger wichtige Häuser geschlossen würden. Zudem könnten Gelder gezielt in eine verbesserte Versorgung strukturschwacher Regionen fließen.
Denkbar wäre, einige der zu schließenden Kliniken in ambulante Versorgungszentren umzubauen, in denen dann auch ambulante Operationen durchgeführt werden können und Kurzzeitaufenthalte über Nacht möglich wären.




Solch eine wirkliche Jahrhundertreform erfordert einen mutigen und langfristig denkenden Gesundheitsminister. Eine Bundesregierung, die den Anspruch hat, „mehr Fortschritt (zu) wagen“ und ein „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ zu bilden, dürfte sich einem klugen Vorstoß ihres Gesundheitsministers nicht verweigern.
Karl Lauterbach hätte mit solch einem Reformvorschlag gute Chancen, sich einen ewigen Spitzenplatz in der recht kleinen ersten Liga der deutschen Gesundheitspolitiker zu sichern.
Mehr: Maskenpflicht, Abstandsgebot, Personenobergrenzen – So sieht der Corona-Plan für den Herbst aus





