Kommentar – Der Chefökonom: Das Ende der Kurzarbeit: Deutschland muss aus dem Krisenmodus aussteigen

Laut einer Ifo-Erhebung waren im Juli noch knapp eine Millionen Menschen in Kurzarbeit.
Die folgenden beiden Meldungen wollen nicht so recht zusammenpassen: Zum einen sehen die Arbeitsagenturen eine deutliche Erholung am Arbeitsmarkt. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung notiert auf sehr hohem Niveau, und die Erwartungen hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung der Arbeitslosigkeit sind optimistisch. Laut einer Ifo-Erhebung waren im Juli nur noch knapp 1,06 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das ist die niedrigste Zahl seit Februar 2020.
Zum anderen hat die Bundesregierung ungeachtet dieses recht günstigen Ausblicks die Finanzhilfen bei der Kurzarbeit weiter verlängert – zunächst bis Ende September, also bis kurz nach dem Termin der Bundestagswahl.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) brachte jüngst sogar eine Verlängerung bis zum Jahresende ins Gespräch. Konkret geht es dabei um die Sozialabgaben für ausgefallene Arbeitsstunden im Falle von Kurzarbeit.
Diese Beiträge sind normalerweise von den Unternehmen zu zahlen. In der Krise werden sie von der Arbeitslosenversicherung und – über die Bundeszuschüsse – letztlich vom Steuerzahler übernommen. Zudem reicht es gegenwärtig für eine Anmeldung von Kurzarbeit aus, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten betroffen sind und nicht wie zuvor vorgesehen ein Drittel.
Für jede Regierung ist es ebenso richtig wie politisch einfach, sich in einer Krise großzügig zu zeigen und damit stabilisierend zu wirken, also Leistungsausweitungen zu beschließen. Politisch weit schwieriger ist es, diese zumeist teuren Hilfsmaßnahmen bei einer Erholung der Wirtschaft wieder zurückzunehmen. Denn was in einer akuten Krise geradezu geboten sein kann, kann bei einem zu langen Einsatz wachstumspolitisch durchaus schädlich sein.
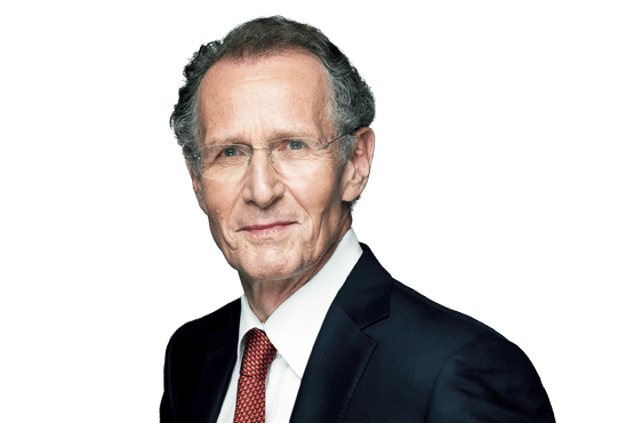
Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com.
Deshalb mahnte bereits im vergangenen Herbst der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dass, sobald eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage erreicht sei, es darum gehen müsse, die für langfristiges Wachstum notwendigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Im Klartext: Stützungsmaßnahmen, die im Notfall ergriffen wurden, sollten bei einer sich abzeichnenden nachhaltigen Erholung rasch beendet werden.
Zu hoch angesetzte Konjunkturprognosen
Nun spricht angesichts der sich gerade aufbauenden vierten Corona-Welle manches dafür, dass die Konjunkturprognosen vieler Auguren von bis zu vier Prozent für dieses Jahr zu hoch gegriffen sind. Doch einen neuerlichen Einbruch mit einem Rückfall der deutschen Volkswirtschaft in die Rezession wird es aller Voraussicht nach im kommenden Winter nicht geben.
Das Kurzarbeitergeld unterliegt wie – vom Grundsatz her – alle Versicherungsleistungen der Gefahr des mit Fehlentwicklungen verbundenen „moralischen Risikos“. Konkret: Je einfacher der Zugang zur Kurzarbeit ist, umso größer sind die Risiken von Ineffizienzen bei der Inanspruchnahme, also insbesondere die strukturkonservierenden Wirkungen.
Denn der Strukturwandel, der wichtigste Wachstumstreiber für reife Volkswirtschaften, wird gebremst, weil Fachkräfte und Kapital zu lange in weniger effizienten und weniger zukunftsorientierten Unternehmen gebunden bleiben.
Nicht ohne Grund sehen die Regelungen zur Zahlung von Kurzarbeitergeld im Regelfall verschiedene Mechanismen vor, um diese wachstumshemmenden Folgen des moralischen Risikos zu minimieren.
Dazu gehörten in erster Linie die zeitliche Befristung der Kurzarbeit sowie die Kostenremanenz, die gewährleisten soll, dass die Lohnkosten für Beschäftigte in Kurzarbeit nicht vollständig nach Maßgabe der wegfallenden Arbeitsstunden sinken. Beide Mechanismen sind derzeit außer Kraft gesetzt.
Arbeitsminister Heil beziffert die Ausgaben für Kurzarbeitergeld seit Anfang 2020 auf 38 Milliarden Euro. Das sei zwar „verdammt viel Geld“. Die Alternative Massenarbeitslosigkeit wäre jedoch für Deutschland „sehr viel teurer“ gewesen. Mit diesen Aussagen hat Heil zweifellos recht.
Nach Krise möglichst schnell wieder arbeiten
Doch eine kluge Wirtschaftspolitik ist dadurch gekennzeichnet, dass klar zwischen Konjunkturpolitik und Wachstumspolitik unterschieden wird. Konjunkturpolitik zielt darauf ab, einen kurzfristigen Ausfall privater Nachfrage durch kreditfinanzierte staatliche Nachfrage oder temporäre Steuersenkungen und Transferzahlungen zu kompensieren – und mit umgekehrten Vorzeichen im Fall einer konjunkturellen Überhitzung zu agieren.
Ziel der Wachstumspolitik ist es, die Angebotsbedingungen einer Volkswirtschaft dauerhaft zu verbessern, um so einen höheren langfristigen Entwicklungspfad der gesamtwirtschaftlichen Leistung zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass in der Krisenpolitik des Frühjahrs 2020 der Frage, wie die Wachstumsmöglichkeiten verbessert werden können, keine sonderliche Relevanz beigemessen wurde. Daher war es naheliegend, dass die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld in vielen Fällen von 60 auf 80 Prozent des Nettolohns, bei Betroffenen mit Kindern gar auf 87 Prozent anhob.
Damit lag diese Leistung deutlich über der des Arbeitslosengelds. Zudem wird seitdem den Arbeitgebern der auf das Kurzarbeitergeld zu entrichtende Arbeitgeberanteil zu den Sozialabgaben erstattet.
Beschäftigten sollten ihre angestammten Arbeitsplätze erhalten bleiben, um deren Zuversicht zu stärken und nach Überwindung der Krise wieder durchstarten zu können. Dadurch wurde und wird der private Verbrauch gestützt, während die Kosten der Unternehmen gesenkt werden.
Die ökonomische Schattenseite ist, dass daraus gleichermaßen bei den Arbeitgebern wie den Gewerkschaften ein großes Interesse erwächst, auch einen der Sache nach gebotenen Personalabbau möglichst lange aufzuschieben.
Und je mehr Unternehmen so agieren, desto größer wird der Druck auf die Bundesregierung, diese strukturkonservierenden Maßnahmen immer wieder zu verlängern, um einen temporären Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern – vor allem in Wahlkampfzeiten.
Regime muss gewechselt werden
Damit steht die nächste Bundesregierung vor der undankbaren, aber gesamtwirtschaftlichen gebotenen Aufgabe, schnellstmöglich vom Regime einer Stützung der privaten Nachfrage zur Anregung und Förderung des Wirtschaftswachstums zu wechseln.
Mit dem Ausstieg aus den konjunkturpolitisch motivierten Krisenhilfen wird die Anzahl der Unternehmenskonkurse steigen, was kurzfristig mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und auch mit individuellen Härten verbunden sein wird.
Aber glaubt man den Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt, so werden derzeit in vielen Branchen Arbeitskräfte gesucht. Dies stützt die Erwartung, dass viele dieser neuen Arbeitslosen bald wieder eine Beschäftigung finden werden – und zwar in Unternehmen, die ohne direkte oder indirekte Staatshilfe am Markt bestehen können und daher zukunftsfähig sind.
So notwendig und richtig es war, zum Beginn der Pandemie die Wirtschaft mit der sprichwörtlichen „Bazooka“ zu stützen, so ökonomisch falsch und zukunftsvergessen wäre es, vor dem Hintergrund eines kurzfristigen Anstiegs der Arbeitslosigkeit die ökonomischen Strukturen aus Vorkrisenzeiten zu konservieren.
Deutschland wird wohl dauerhaft mit dem Coronavirus leben müssen, so wie es auch mit den Erregern anderer Infektionskrankheiten gelungen ist. Manche, bislang erfolgreiche Geschäftsmodelle werden sich ändern müssen oder vom Markt verschwinden.






In einer Sozialen Marktwirtschaft sollte es jedoch ein zentrales Ziel der Wirtschaftspolitik sein, den Wettbewerb auf Märkten sicherzustellen und den Strukturwandel zu fördern, aber keineswegs zu verhindern.
Denn nur dann ist es möglich, das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu stimulieren, trotz Bevölkerungsalterung den Wohlstand möglichst vieler Bürger zu erhöhen und die ökologisch gebotene Dekarbonisierung wie geplant durchzusetzen. Dieser Aspekt ist angesichts der zahlreichen neuen Leistungsversprechen im Wahlkampf bislang zu kurz gekommen – leider.





