Kommentar – Der Chefökonom: Das Märchen der sich selbst finanzierenden Steuerreform: Nach der Bundestagswahl ist Realismus gefragt

Eine Unternehmensteuerreform mit niedrigeren Sätzen und günstigeren Abschreibungsregeln wäre dem Autor zufolge geboten.
Wie vor jeder Bundestagswahl wird in Deutschland über Steuerpolitik gestritten – und dieses Mal nicht nur zwischen den politischen Lagern, sondern sogar innerhalb der Union. Die Parteien des bürgerlich-konservativen Lagers versuchen mit dem Versprechen zu punkten, möglichst alle Bürger steuerlich zu entlasten – und setzen dabei auf die Selbstfinanzierungseffekte von Steuersenkungen.
Die Parteien links der Mitte wollen ihrer Klientel glaubhaft machen, dass die anstehenden Aufgaben allein dadurch finanziert werden können, dass einige wenige gutverdienende Bürger zusätzliche Reichen- oder Vermögensteuern zahlen müssen.
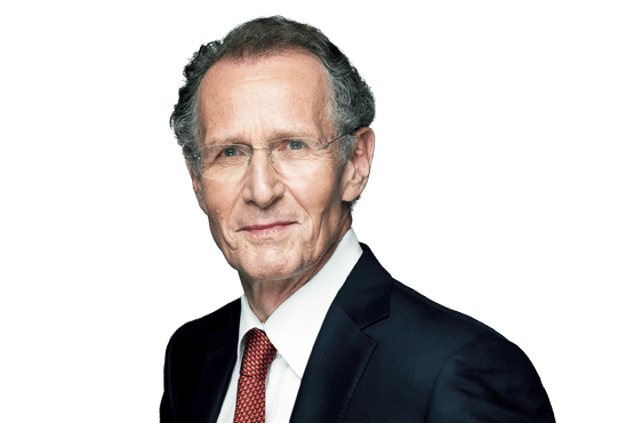
Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com.
Durch die Brille des Ökonomen betrachtet sind Steuern auf das Erwerbseinkommen zunächst einmal schädlich, denn sie treiben einen Keil zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. Und je höher der Steuersatz, desto breiter wird dieser Keil.
Im Extremfall, also bei einem Steuersatz von 100 Prozent, wird niemand mehr bereit sein zu arbeiten, weil die damit verbundenen Mühen das Nettoeinkommen nicht erhöhen. Der US-Ökonom Arthur B. Laffer leitete 1974 – der Legende nach bei einem Abendessen mit ranghohen Mitarbeitern des damaligen US-Präsidenten Gerald Ford – daraus ab, dass die Steuereinnahmen mit steigendem Steuersatz zunächst anwachsen, um nach dem Erreichen eines Maximums wieder zu sinken. Der Verlauf der Funktion ähnele einem auf dem Kopf stehenden „U“.
Das Problem der sich selbst finanzierenden Steuerreform
Somit gäbe es einen Punkt, ab dem höhere Steuersätze zu einem geringeren Aufkommen führten. Ist dieser Punkt überschritten, führten niedrigere Steuersätze zu einem steigenden Aufkommen. Damit war die Legende der sich selbst finanzierenden Steuerreform geboren.
Das Problem dabei: Niemand kennt diesen Wendepunkt oder kann ihn berechnen. So kam es, dass US-Präsident Ronald Reagan, der ein großer Anhänger von Laffers Idee war, mit seinem „Economic Recovery Tax Act“ den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer von 70 Prozent mehr als halbierte. Da das Steueraufkommen jedoch entgegen seinen Erwartungen nicht stieg, sondern einbrach, hinterließ er seinem Nachfolger ein gigantisches Haushaltsdefizit.
Diese Erfahrungen ändern nichts daran, dass heute die Befürworter von Steuersenkungen ähnlich argumentieren: Geringere Steuersätze erhöhten das Wirtschaftswachstum, da diese niedrigeren Steuersätze das Arbeits- oder Kapitalangebot steigen ließen. Die dadurch erhöhte Wirtschaftsleistung führe wiederum zu höheren Steuer- und Beitragseinnahmen des Staates.
An dieser Argumentation ist zunächst wenig auszusetzen. Allerdings ist sie unvollständig. Denn sie lässt die Frage unbeantwortet, ob die erzeugten Wachstumseffekte groß genug sind, damit der Staat am Ende mindestens gleich hohe Steuereinnahmen wie zuvor erzielt.
Tatsächlich ist dies regelmäßig nicht der Fall, wie folgende Überschlagsrechnung verdeutlicht: Die Steuerquote beträgt in Deutschland rund 23 Prozent. Ein um eine Milliarde Euro höheres Bruttoinlandsprodukt führt also zu 230 Millionen Euro höheren Steuereinnahmen.
Die Rechnung geht für den Fiskus nicht auf
Nun stimulieren Steuersenkungen isoliert betrachtet zweifellos das Wachstum und erhöhen für sich genommen das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Doch damit die Rechnung für den Fiskus aufgeht, müsste für jede Milliarde Euro an steuerlicher Entlastung die Wirtschaftsleistung um etwa vier Milliarden Euro steigen – was höchst unrealistisch ist.
Selbst wenn man bedenkt, dass eine höhere Wirtschaftsleistung auch mit höheren Sozialabgaben einhergeht, geht die Rechnung nicht auf. Denn andererseits kommt hinzu, dass der Staat mit seinen Einnahmen zumeist selbst zur Steigerung der Wirtschaftsleistung beiträgt, in dem er investiert oder mehr Personal einstellt. Die eingenommenen Steuern sind gesamtwirtschaftlich also keineswegs verloren, was den Selbstfinanzierungseffekt von Entlastungen verringert.
Schuldenfinanzierte Steuersenkungen mögen daher politisch attraktiv sein, kollidieren aber mit der geltenden Schuldenbremse und können zudem ökonomisch wirkungslos sein, wenn heutige Schulden als künftige Steuern wahrgenommen werden.
Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat die Einkommensteuerpläne der Parteien unter die Lupe genommen, freilich ohne Verhaltensänderungen zu berücksichtigen, da diese niemand kennt. Die FDP-Pläne kämen vor allem Gutverdienern zugute und würden die öffentlichen Hände 88 Milliarden Euro kosten.
Die Wirtschaftsleistung müsste also um rund 380 Milliarden Euro steigen, damit sich entsprechend der Faustformel diese Reform selbst finanziert. Dazu wäre ein zusätzlicher Wachstumsschub von etwa zehn bis zwölf Prozent erforderlich.
Steuersenkungen und die CDU
Die Pläne der CDU/CSU sind weniger weitreichend als die der FDP, weisen aber in dieselbe Richtung. Damit die angestrebte Entlastung von 33 Milliarden sich selbst finanziert, müsste das BIP als Folge dieser Steuerreform um reichlich vier Prozent steigen. Selbst das ist unrealistisch.
Steuersenkungen kosten den Staat also stets Geld – Geld, über das die öffentlichen Hände nicht zuletzt als Folge der Corona-Pandemie nicht verfügen. Dies muss wohl auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet erkannt haben, als er die im Wahlprogramm der Union gemachten Versprechen kurzerhand mit einem Finanzierungsvorbehalt versah. „Grundbotschaft ist: keine Steuererleichterung im Moment. Dazu haben wir nicht das Geld“, sagte Laschet nüchtern in einem Interview.
Das rief die CSU auf den Plan. Parteichef Markus Söder betonte, „Steuerentlastungen sind die Grundphilosophie der Union – das ist der Unterschied zur politischen Linken: Grüne wollen Steuern erhöhen, wir wollen senken“, verkündete Markus Söder. „Für die CSU gehört die Entlastung von Mittelstand und Handwerk zu einer Toppriorität“ – was für ihn von nachrangiger Priorität ist, also zur Finanzierung der Steuersenkungen entfallen sollte, verriet er hingegen nicht.
Nun ist es zu begrüßen, dass in Deutschland wieder über Steuerpolitik diskutiert wird. Allerdings wäre mehr Ehrlichkeit in der Debatte wünschenswert: Die erste Wahrheit lautet, keine Steuersenkung finanziert sich selbst, und die zweite Wahrheit lautet, für echte Entlastung fehlt das Geld.
Das bedeutet freilich nicht, dass die kommende Regierung steuerpolitisch untätig bleiben sollte. Denn die dritte Wahrheit lautet, dass die Wachstums- und damit die Selbstfinanzierungseffekte von Unternehmensteuersenkungen deutlich höher sind, als jene von Mehrwertsteuersenkungen oder von Entlastungen für Gutverdiener.
Eine Unternehmensteuerreform mit niedrigeren Sätzen ist geboten
Deutschland steht im internationalen Wettbewerb um mobiles Kapital, also um private Investitionen. Und in kaum einem anderen Industrieland werden Gewinne von Kapitalgesellschaften derzeit ähnlich hoch belastet, wie in Deutschland.
Weil nun einmal die Nach-Steuer-Rendite eine entscheidende Größe für Investitionen ist, machen Investoren immer öfter einen Bogen um Deutschland. Daher wäre eine Unternehmensteuerreform mit niedrigeren Sätzen und günstigeren Abschreibungsregeln geboten.
Würde diese durch eine gesamtwirtschaftlich weniger schädliche moderate Erhöhung des Regelsatzes der Mehrwertsteuer gegenfinanziert, könnte Deutschland auf einen höheren Wachstumspfad gelangen, ohne dass die öffentlichen Haushalte überstrapaziert würden oder andere wichtige Ausgaben gekürzt werden müssten.
Sicher, solch ein Reformplan, bei dem es nun einmal nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer gibt, ist wenig wahlkampftauglich. Doch spätestens bei den Koalitionsverhandlungen wird für alle nach Regierungsverantwortung strebenden Parteien die Zeit kommen, sich von vielen ihrer Wahlkampfversprechen zu verabschieden.



Auf Laffers unrealistische Ideen zu vertrauen würde es Deutschland vollends unmöglich machen, die anstehenden fiskalischen Herausforderungen wie die Dekarbonisierung und die Alterung der Gesellschaft zu bewältigen. Ab dem 27. September ist Realismus gefragt.





