Kommentar – Der Chefökonom: Durch mehr Geschlechtergerechtigkeit wäre in Deutschland mehr Wohlstand möglich

Der Durchschnittsverdienst 2020 lag bei Männern bei 22,78 Euro pro Stunde, Frauen verdienten 18,62 Euro.
Berufstätige Frauen hatten im vergangenen Jahr in Deutschland gegenüber Männern einen Lohnrückstand von 18 Prozent. Aus diesem Grund wurde am vergangenen Mittwoch der „Equal Pay Day“ begangen, jener Tag im Jahr, bis zu dem Frauen umsonst gearbeitet haben.
Dabei muss man freilich wissen, dass die amtliche Statistik diese 18 Prozent als „unbereinigte Lohnlücke“ bezeichnet. Während im Jahr 2020 Männer im Durchschnitt 22,78 Euro die Stunde verdienten, waren es bei den Frauen 18,62 Euro. Einflussfaktoren wie Ausbildung, Branche, Berufserfahrung oder Betriebszugehörigkeit blieben dabei berücksichtigt.
Außerdem weisen Länder mit sehr niedrigem Gender-Pay-Gap häufig auch eine sehr niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen auf. So haben etwa Rumänien und Italien neben niedrigen Lohnlücken auch niedrige Frauenerwerbsquoten, während einige Länder mit hohen Erwerbsquoten deutlich höhere Gender-Pay-Gaps aufweisen.
Erwerbsbiografien von Frauen sind oft von Zeiten der Kindererziehung unterbrochen. Zudem arbeiten Frauen öfter in unterdurchschnittlich bezahlenden Branchen und häufig nicht in Vollzeit. Berücksichtigt man diese Faktoren, verbleibt für Deutschland eine „bereinigte Lohnlücke“ von sechs Prozent. Dies ändert nichts daran, dass Frauen in der Arbeitswelt gegenüber Männern benachteiligt sind – bei Einstellungschancen, Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten und der Besetzung von Führungspositionen.
Gender-Pay-Gap: Frauen sind mindestens so gut qualifiziert wie Männer
Schätzungen zufolge wird in Deutschland nur etwa jedes dritte Unternehmen von einer Frau geführt. Bei technologieorientierten Start-ups ist diese Quote noch geringer. In Großbetrieben der Privatwirtschaft mit mindestens 500 Beschäftigten sind nur 14 Prozent der Führungspositionen auf der ersten Ebene mit Frauen besetzt. Und die Selbstständigenquote von Frauen ist mit 7,6 Prozent nur halb so hoch wie bei Männern.
Tatsächlich sind junge Frauen heute mindestens genauso gut qualifiziert wie Männer: 55 Prozent der Schulabsolventen mit allgemeiner Hochschulreife sind weiblich, und fast 52 Prozent der Abschlussprüfungen an Hochschulen werden von Frauen absolviert.
Da der Staat pro Kopf keineswegs weniger Geld in die Qualifikation von Frauen investiert als in die von Männern, grenzt es an Steuergeldverschwendung, wenn viele Frauen nach Ausbildung oder Studium geringfügig oder in Teilzeit arbeiten – was sie zumeist ihrer Aufstiegschancen beraubt. Viel Potenzial liegt also brach.
Nun steuert die deutsche Volkswirtschaft auf einen massiven Alterungsschub zu, der Mitte dieses Jahrzehnts einsetzen wird. Eine Folge wird ein großflächiger Fachkräftemangel sein. Ungenutztes Humankapital kommt die deutsche Volkswirtschaft also teuer zu stehen.
In den vergangenen Dekaden ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen merklich gestiegen. Nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamts waren 2019 drei von vier Müttern mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig. Zum Vergleich: Der Anteil der erwerbstätigen Väter lag bei 92,9 Prozent. Doch arbeiten zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter in Teilzeit; bei Vätern waren es zuletzt 6,4 Prozent. Die traditionelle Rollenverteilung gilt also in vielen Familien immer noch – wenn auch in abgeschwächter Form: Der Mann ist häufig nicht mehr der Alleinverdiener, gleichwohl aber der Hauptverdiener.
Ehegattensplitting 2021: Maximaler Vorteil beträgt 18.321 Euro
Für die Festschreibung dieser Rollenverteilung wird oft das Ehegattensplitting in der Einkommensteuer verantwortlich gemacht. „Die Besteuerung läuft falsch“, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im Handelsblatt-Interview. „Mit dem Ehegattensplitting fördern wir immer noch die klassische Einverdienerfamilie.“ Das führe zu dem „Fehlanreiz, dass die Frauen zu Hause bleiben oder in Teilzeit gehen“.
Dazu muss man wissen: Beim Splitting wird das steuerpflichtige Einkommen beider Partner addiert, um dann je zur Hälfte beiden Ehepartnern zugerechnet zu werden. Die steuerliche Belastung ist dann für beide gleich. Wegen des progressiven Tarifs mit steigenden Grenzsteuersätzen führt dies im Vergleich zur Einzelveranlagung zu einem Vorteil, sofern das Einkommen beider Partner verschieden ist und wenigstens eines unterhalb der Grenze liegt, ab der der Spitzensteuersatz greift.
Der maximale Splittingvorteil beträgt derzeit 18.321 Euro. Zum Tragen kommt dieser, wenn ein Partner mehr als 550.000 Euro verdient und der andere gar nichts.
Die Kehrseite dieses Vorteils für Ehepaare ist, dass das Einkommen des Zweitverdieners – und damit oft der Frau – einer hohen Grenzbelastung unterliegt, die als leistungsfeindlich angesehen wird. Insbesondere geringfügige Beschäftigungen, auf die die Minijobber keine Steuern und Sozialabgaben zahlen müssen, werden dadurch sehr attraktiv, während bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung rasch Abzüge von über 50 Prozent fällig werden.
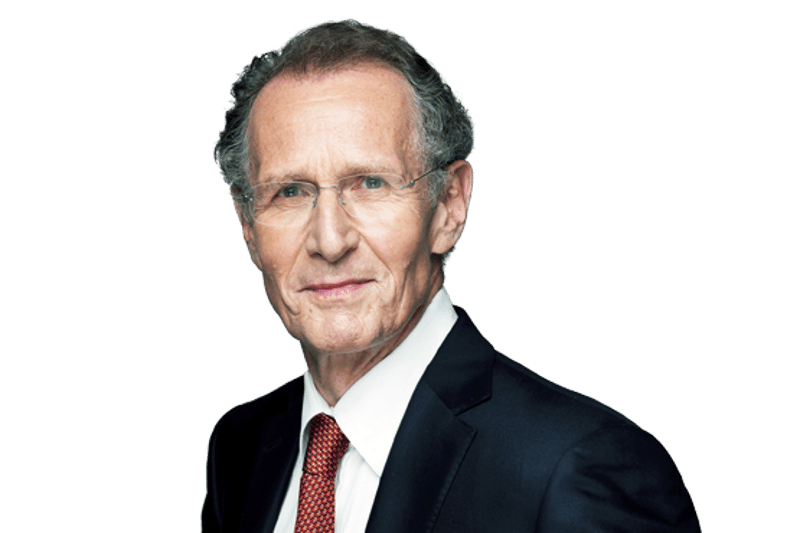
Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com.
Dennoch ist das Splitting besser als sein Ruf. Denn es ist die einzige Form der Ehegattenbesteuerung, die gewährleistet, dass zwei Ehepaare mit identischem Gesamteinkommen stets gleich belastet und dass Ehepaare nie gegenüber unverheirateten Paaren benachteiligt werden. Beides dürften weite Teile der Bevölkerung als gerecht empfinden.
Die leistungsfeindlichen Anreize, die vom Splitting ausgehen, treten vor allem im Zusammenspiel mit anderen – gut gemeinten – Steuer- und Sozialregeln offen zutage. So sind nicht erwerbstätige Ehepartner beitragsfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert. Sobald jedoch einer regulären Erwerbstätigkeit nachgegangen wird, werden Beiträge fällig.
Zudem können Ehepaare durch geschickte Steuerklassenwahl ihr monatliches Nettogesamteinkommen optimieren. Dabei wird der Hauptverdiener unterjährig entlastet und der Zweitverdiener belastet. Letzteres wird oft als unfair empfunden, auch wenn die resultierenden Vor- oder Nachteile im Rahmen der Steuerklärung ausgeglichen werden.
Ehegattensplitting: Reform würde Gender Pay-Gap verringern
Nun sollte es sich unsere schnell älter werdende Gesellschaft nicht leisten, dass ein großer Teil der oft gut qualifizierten Erwerbsbevölkerung lediglich geringfügig oder in Teilzeit arbeitet. Daher muss es eine der zentralen Aufgaben der nächsten Bundesregierung sein, Hindernisse für das Arbeitsangebot von Frauen abzubauen.
Die Reform des Splittings wäre dabei ein Baustein einer Gesamtstrategie, mit der nicht nur die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöht, sondern vor allem mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigungen gebracht und damit ihre Chancen auf Führungspositionen verbessert würden. Da eine reine Individualbesteuerung von Ehepaaren verfassungswidrig sein dürfte, käme ein Realsplitting als Reformoption infrage.
Dabei würden (fiktive) Unterhaltszahlungen des Besserverdieners bis zu einer bestimmten Höhe von dessen Bemessungsgrundlage abgezogen – und wären im Gegenzug beim (fiktiven) Empfänger steuerpflichtig. Auf diese Weise würde der Splittingvorteil begrenzt, aber auch dessen nachteilige Effekte.
Allein durch höhere Leistungsanreize wird sich der Gender-Pay-Gap allerdings nicht schließen lassen. Denn niemand kann, will und sollte verhindern, dass viele Frauen eben Berufe wählen, die sich gut in Teilzeit ausüben lassen oder die mit eher schlechten Einkommensperspektiven verbunden sind.




Angesichts der hohen Bildungsbeteiligung der Frauen sollte die Politik dennoch bedacht sein, Hindernisse für eine Vollzeitbeschäftigung beider Elternteile abzubauen. Es gilt, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer alternden Erwerbsbevölkerung möglichst weitgehend auszunutzen.
Dazu gehören – neben einer klugen Reform des Splittings – in erster Linie echte Ganztagsangebote in der Kinderbetreuung sowohl im schulischen wie im vorschulischen Bereich. Solche Angebote sind einer der wichtigsten Gründe dafür, dass der Equal Pay Day in den meisten entwickelten Staaten deutlich vor dem 10. März liegt. Denn Deutschland ist eines der letzten Industrieländer, in denen eine ganztägige (vor)schulische Betreuung nicht die Regel ist.
Mehr: Zentrale Aufgabe der nächsten Bundesregierung ist eine Post-Corona-Wirtschaftspolitik, meinen Bert Rürup und Axel Schrinner





