Kommentar – der Chefökonom: Ein Kanzler Olaf Scholz könnte als Reformer in die Geschichtsbücher eingehen

Der damalige Kanzler und Scholz machen in Hamburg gemeinsam Wahlkampf.
„It took Nixon to go to China.“ Diese Metapher entstand, nachdem der erklärte Antikommunist Richard Nixon 1972 überraschend den chinesischen Diktator Mao Zedong besuchte. Damit leitete der damalige US-Präsident die Normalisierung der Beziehungen beider Staaten ein und zementierte die Abnabelung Chinas von der Sowjetunion, dem damaligen Widersacher Nummer eins der USA.
Heute steht diese Metapher für die gut belegte Vermutung, dass weitreichende Reformen oft von Politikern durchgesetzt werden, denen man zum Amtsantritt nicht zugetraut hätte, Positionen der Opposition zu übernehmen und diese damit faktisch auszuschalten.
So erwartete im Herbst 1998 kaum ein Politikbeobachter, dass die neue rot-grüne Regierung unter dem Ex-Juso-Chef Gerhard Schröder sich an einer militärischen Intervention im Kosovokonflikt beteiligen, nach den Terroranschlägen in New York mit den „Schily-Paketen“ die Maßnahmen zur inneren Sicherheit massiv verschärfen, die Finanzmärkte liberalisieren, eine mutige Einkommen- und Unternehmensteuerreform verabschieden und zudem die umfassenden Sozialreformen der „Agenda 2010“ auf den Weg bringen würde.
Heute sind nicht wenige Auguren der Ansicht, dass damals die Saat für das zurückliegende goldene Jahrzehnt der deutschen Volkswirtschaft gelegt wurde, deren Früchte Angela Merkel ernten konnte.
Olaf Scholz war von Oktober 2002 bis März 2004 SPD-Generalsekretär und damit letztlich das Sprachrohr von Parteichef Schröder. Seitdem hat sich der dem konservativen Seeheimer Kreis zugerechnete Jurist in zahlreichen politischen Ämtern bewährt.
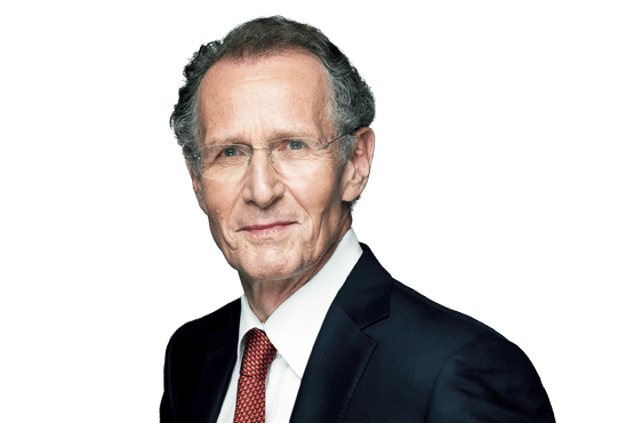
Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zu seiner Arbeit und seinem Team unter research.handelsblatt.com.
Zuletzt wurde ihm als Folge des unverkennbaren Linksrucks der SPD der Parteivorsitz verweigert, die Kanzlerkandidatur jedoch diskussionslos zugestanden. Nun scheint für ihn das Kanzleramt in greifbarer Nähe – und sollte die SPD tatsächlich stärkste Partei werden, wird es nicht lange dauern, bis Scholz auch nach dem Parteivorsitz greift.
Auf Euphorie dürfte Ernüchterung folgen
Wird eine neue Regierung ohne die Union gebildet, dürfte sie sich in der Euphorie des Neustarts in der Sozial- und Klimapolitik zunächst zu Übertreibungen hinreißen lassen – trotz einer Beteiligung der FDP. Doch recht bald wird Ernüchterung einsetzen.
Zum einen hat die Coronakrise die Staatskassen gelehrt. Zum anderen wird der bald einsetzende Alterungsschub die Wachstumsperspektiven der Volkswirtschaft und damit die Lage öffentlichen Finanzen merklich verschlechtern.
Die Aufwendungen für die zwischen 2014 bis 2020 beschlossenen Leistungsausweitungen in der Rentenversicherung und für die Dekarbonisierung der Wirtschaft dürften sich bald in Form neuer Zwangsabgaben bemerkbar machen. Dauerhaft höhere Schulden sind kein Ausweg, da es für ein Ende der Schuldenbremse keine Bundesratsmehrheit geben wird. Der Unmut in der Bevölkerung wegen der schwachen gesamtwirtschaftlichen Performance wird steigen, sodass ein 180-Grad-Schwenk hin zu einer Beschäftigung und Wachstum stimulierenden Politik wahrscheinlich ist.
Ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt, dass kein Weg daran vorbeiführt, die knapper werdenden Gelder in den Sozialsystemen zielgerichteter einzusetzen. Die von vielen Ökonomen empfohlene Anhebung des Renteneintrittsalters ist angesichts der Unpopularität dieser Option wenig wahrscheinlich. Sollen dennoch Beitragssatz und Rentenniveau weitgehend stabil bleiben, muss innerhalb des Systems stärker von Reich zu Arm umverteilt werden, auch um Altersarmut zu begrenzen.
Sobald Corona als besiegt gilt, werden in der Gesundheitspolitik die Überkapazitäten bei den Krankenhausbetten wieder auf die Tagesordnung kommen. Zudem dürften durch mehr Selbstbeteiligung die fiskalischen Risiken einer übermäßigen Inanspruchnahme ambulanter Leistungen angegangen werden. Der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingeleitete Umbau der Pflegeversicherung von einer Teilabsicherung hin zu einer Vollabsicherung mit Selbstbehalt wird sich als unbezahlbar herausstellen und revidiert werden.
In der Klimapolitik dürften symbolträchtige Verbote und Subventionen an Bedeutung verlieren, während Effizienz in den Vordergrund gerückt wird. Der Schlüssel ist eine umfassende CO2-Bepreisung, damit Emissionen dort reduziert werden, wo dies am billigsten zu realisieren ist. Planwirtschaftliche Attitüden, die zu fallweisen lenkenden Eingriffen verleiten, werden sich als zu teuer erweisen.
Vor allem aber wird auf internationalem Parkett für den Klimaschutz zu werben sein. Die Erderwärmung ist ein globales Problem, das Deutschland nicht ansatzweise allein bewältigen kann; der deutsche Anteil an den globalen CO2-Emissionen beträgt zwei Prozent, der von China 30 und der der USA 15 Prozent. Niemand, schon gar nicht das Klima, hat etwas davon, wenn die deutsche Industrie nachhaltig geschwächt wird und chinesische Unternehmen die entstehenden Lücken für die eigene Expansion nutzen.
Ifo: Niedrige Steuern für Unternehmen bringen Wachstum
All dies kostet Geld. Daher wird sich die nächste Regierung daran erinnern, dass die beste „Gelddruckmaschine“ das Wachstum der Wirtschaft ist. Ein Prozent zusätzliches Bruttoinlandsprodukt beschert dem Staat knapp 15 Milliarden Euro zusätzliche Steuer- und Beitragseinnahmen – und zwar dauerhaft. Die entscheidenden Faktoren für das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft sind das Angebot von Arbeit und Kapital, also Angebotsfaktoren, die maßgeblich vom Steuersystem beeinflusst werden können.
Eine neue Ifo-Studie zeigt, dass niedrigere Steuern für Unternehmen höhere Löhne, mehr Beschäftigung und höheres Wachstum generieren. Eine Senkung der Unternehmensteuer von 30 auf 25 Prozent sowie deutlich verkürzte Abschreibungszeiträume von vier anstatt zehn Jahren verringern zwar kurzfristig das Steueraufkommen um 30 Milliarden Euro. Doch die Wirtschaftsleistung und der Konsum privater Haushalte wären nach einer kurzen Anpassungszeit um etwa drei Prozent höher als ohne Reform. Die Beschäftigung würde um 1,4 Prozent steigen, und die Löhne zögen um etwa vier Prozent an.
Freilich muten die von Ifo unterstellten Selbstfinanzierungseffekte und damit der Spielraum für Entlastungen recht optimistisch an. Zudem dürfte es zur Wahrung der politischen Hygiene auch Belastungen für die Wirtschaft geben. Die von nicht wenigen Parteien herbeigesehnte Vermögensteuer wird aber nicht kommen – in Ermangelung der notwendigen Bundesratsmehrheit. Stattdessen dürfte die neue Regierung eine umfassende Erbschaftsteuerreform angehen, die für den ein oder anderen Erben sicher mit höheren Belastungen verbunden sein wird.
Eine große Einkommensteuerreform – so wünschenswert sie wäre – wird am Geld scheitern. Denkbar wären aber mehrere, womöglich noch nicht fest terminierte Reformstufen. Dabei dürfte der überfällige Wegfall des Solis mit leicht höheren Spitzensteuersätzen ausgeglichen und der Tarifverlauf gestreckt werden.
Gut möglich, dass zudem der Regelsatz der Mehrwertsteuer erhöht wird, um mit den Einnahmen gezielt im Wahlkampf versprochene Klimaschutz- und Sozialprojekte finanzieren zu können. Auch wenn solch ein Projekt ganz sicher einen anderen Namen bekommen wird, hätte eine „Agenda 2030“ das Potenzial, der deutschen Wirtschaft trotz Bevölkerungsalterung neuen Schwung zu verleihen.
Natürlich, zu Beginn der Post-Merkel-Ära wird manches kräftig ruckeln. Schließlich müssen nicht nur die Interessen von SPD, Grünen und FDP unter einen Hut gebracht werden, sondern auch die der verschiedenen Flügel dieser Parteien.
Positiv gewendet wird dies das disruptive Moment sein, welches stets markanten Veränderungen vorausgeht. Allen beteiligten Parteien und Politikern wird an einem Gelingen dieses Projekts mehr gelegen sein als an einer Selbstdemontage, wie dies in den vergangenen Jahren vor allem für die SPD charakterisierend war.




Welch fatale Folgen so etwas für eine Partei haben kann, dürfte die Union am Abend des 26. September schmerzhaft erleben. Denn, um es mit den Worten des SPD-Granden Franz Müntefering zu sagen, „Opposition ist Mist“.
Mehr: Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Bundestagswahlkampf in unserem Newsblog





